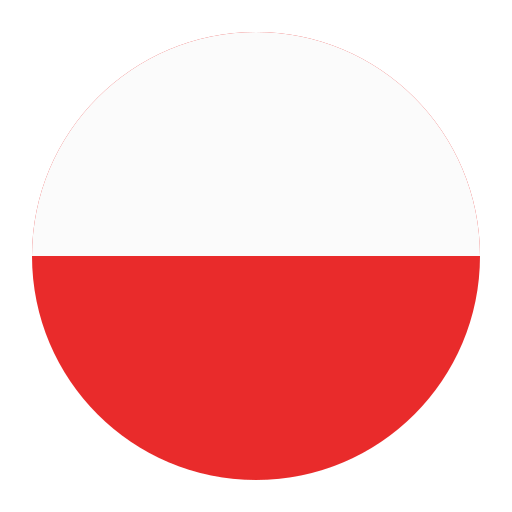NFC zu H9
FORSCHUNG UND LETZTE KRIEGSJAHRE
Willi Baumert gab 1948 zu, dass er nach Berlin in die »Kanzlei des Führers« gefahren sei, um Ziel und Zweck der »Kinderfachabteilung« zu erfahren. Hierbei habe Hans Hefelmann ihm mitgeteilt, dass an den Kindern und Jugendlichen Ursachen von Beeinträchtigungen erforscht werden. Die Ergebnisse sollten zur Vorbeugung von Erkrankungen und Behinderungen beitragen. Außerdem sollte das »Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« verbessert werden.
FORSCHUNG UND LETZTE KRIEGS-JAHRE
Willi Baumert ist Arzt in der Kinder-Fachabteilung.
Nach dem Krieg im Jahr 1948 sagt er:
Ich bin in der Nazi-Zeit nach Berlin gefahren.
Denn ich wollte wissen,
warum es Kinder-Fachabteilungen gibt.
Ich habe in Berlin mit Hans Hefelmann gesprochen.
Er war Leiter vom Büro von Adolf Hitler.
Hans Hefelmann erzählte mir:
Kinder mit Behinderungen und Krankheiten sollen erforscht werden.
Die Forschung will wissen,
• warum die Kinder krank sind.
• warum die Kinder eine Behinderung haben.
Darum muss man Versuche
mit den Kindern machen.
Die Versuche machen wir
in den Kinder-Fachabteilungen.
Es soll keine Behinderungen mehr geben.
Es soll keine Krankheiten mehr geben.
Die Versuche mit Kindern sollen dabei helfen.
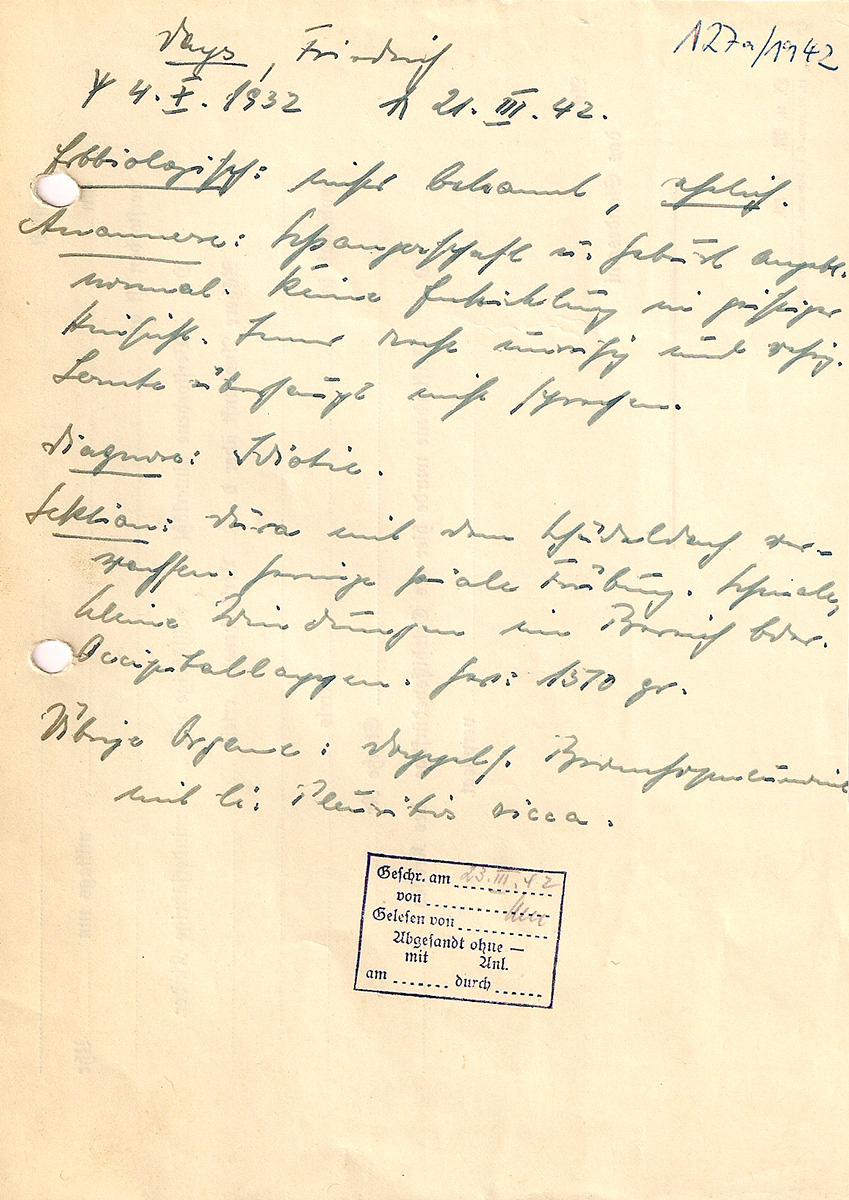
Auszug aus der Mitschrift der Leichenöffnung von 338 Kindern und Jugendlichen, in diesem Fall Friedrich Daps vom 23.3.1942.
PrivatbesitInstitut für Geschichte und Ethik der Medizin Hamburg.
Die Forschung erfolgte zum einen durch Beobachtung und Intelligenzprüfung. Zum anderen wurden die Kinder und Jugendlichen körperlich untersucht. Hierfür wurden Blut und Gehirnflüssigkeit abgenommen, aus den Kinderleichen die Organe entnommen. Im Keller von Haus 25 wurde ein Raum eingerichtet, in dem die Leichen geöffnet werden konnten. Willi Baumert führte 338 solcher Eingriffe durch und entnahm die Gehirne. Er untersuchte sie und schrieb alles auf.
Die Ärzte in der Kinder-Fachabteilung erforschen die Kinder:
• Sie beobachten die Kinder.
• Sie messen die Intelligenz von den Kindern.
• Sie prüfen das Denken von den Kindern.
• Sie prüfen,
wie fit der Körper von den Kindern ist.
• Sie untersuchen das Blut von den Kindern.
• Sie untersuchen das Gehirn-Wasser
von den Kindern.
Die Ärzte untersuchen auch tote Kinder.
Sie schneiden die Leichen von den Kindern auf.
Sie nehmen die Organe aus den Leichen raus.
Sie schneiden den Kopf auf und
nehmen das Gehirn raus.
Das alles passiert in Lüneburg
in einem Keller-Raum in Haus 25.
Der Arzt Willi Baumert macht das alles
Er macht das bei 338 Kinder-Leichen.
Und er schreibt alles auf.
Viele Organe gab er an das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (etwa 37 Abgaben sind belegt). Dort wurden hauchdünne Schnitt-Präparate angefertigt. Als Willi Baumert im August 1944 wieder in den Kriegseinsatz musste, übernahm Max Bräuner die Entnahme und Untersuchung der Gehirne.
Willi Baumert gibt die Gehirne
von den toten Kindern weiter an andere Ärzte.
Er gibt die Gehirne von 37 toten Kindern
an das Krankenhaus in Hamburg-Eppendorf.
Die Ärzte im Krankenhaus in Hamburg untersuchen die Gehirne von den toten Kindern.
Sie schneiden die Gehirne in dünne Scheiben.
Dann können sie die Gehirne
unter einem Vergrößerungs-Glas untersuchen.
Willi Baumert ist ab dem Jahr 1944 nicht mehr
in Lüneburg.
Er muss als Arzt in den Krieg.
Max Bräuner übernimmt seine Aufgaben.
Jetzt untersucht er die Leichen von den Kindern.
Und er nimmt die Organe aus den Leichen heraus.Willi Baumert gibt die Gehirne
von den toten Kindern weiter an andere Ärzte.
Er gibt die Gehirne von 37 toten Kindern
an das Krankenhaus in Hamburg-Eppendorf.
Die Ärzte im Krankenhaus in Hamburg untersuchen die Gehirne von den toten Kindern.
Sie schneiden die Gehirne in dünne Scheiben.
Dann können sie die Gehirne
unter einem Vergrößerungs-Glas untersuchen.
Willi Baumert ist ab dem Jahr 1944 nicht mehr
in Lüneburg.
Er muss als Arzt in den Krieg.
Max Bräuner übernimmt seine Aufgaben.
Jetzt untersucht er die Leichen von den Kindern.
Und er nimmt die Organe aus den Leichen heraus.
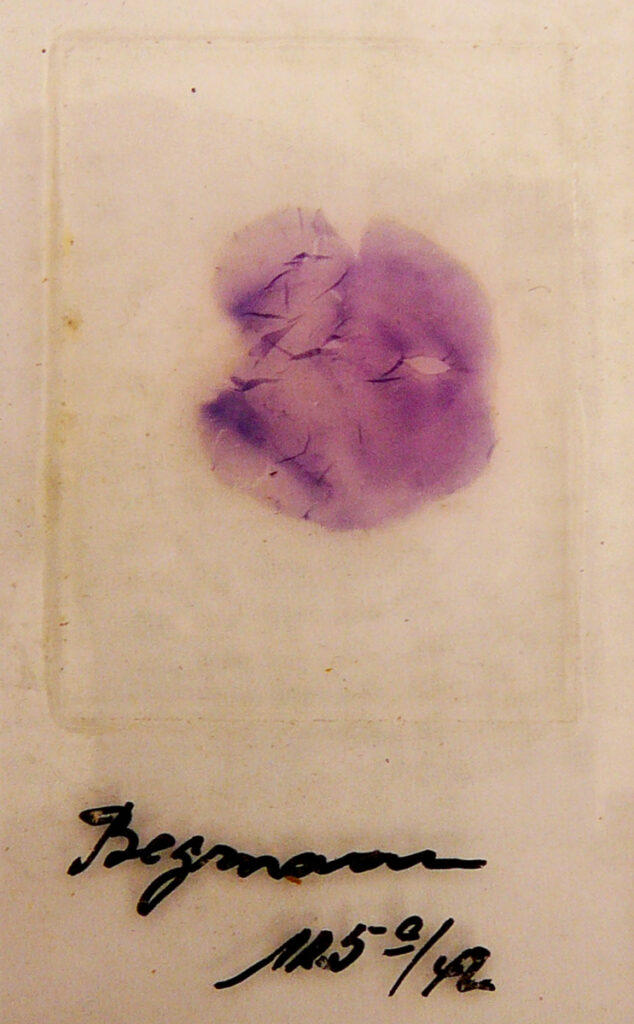
Objektträger mit Schnitt von Marianne Begemann, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), 1942.
Institut für Geschichte und Ethik der Medizin Hamburg.
Dies sind die Namen der Kinder und Jugendlichen, deren Gehirne und weitere Organe an die Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf (UKE) abgegeben wurden:
Das sind die Namen von den Kindern,
die in Lüneburg ermordet werden.
Ihre Gehirne und Organe hat man
an das Krankenhaus in Hamburg gegeben.

Anita, Helga und Helmut Volkmer, etwa 1937.
Privatbesitz Marlene Volkmer.
Das erste Gehirn, das für die Forschung nach Hamburg gegeben wurde, war das von Helga Volkmer. Sie wurde am 30. November 1941 ermordet und gehörte zu den ersten Opfern der Lüneburger »Kinder-Euthanasie«. Sie ist der Beleg, dass die Lüneburger »Kinderfachabteilung« ihre Arbeit nicht erst 1942 mit den ersten »Reichsausschuss«-Kindern begann, sondern mit Ankunft der Kinder aus den Rotenburger Anstalten der Inneren Mission.
Helga Volkmer ist in der Nazi-Zeit
in der Kinder-Fachabteilung in Lüneburg.
Sie wird am 30. November 1941 ermordet.
Willi Baumert nimmt das Gehirn aus Helgas
totem Körper.
Er untersucht das Gehirn.
Die Ärzte in der Kinder-Fachabteilung Lüneburg machen das bei Helga zum ersten Mal.
Helga Volkmer ist das erste bekannte Opfer
von Hirn-Forschung.
Das ist ein Foto von Helga Volkmer und
ihren Eltern aus dem Jahr 1937.
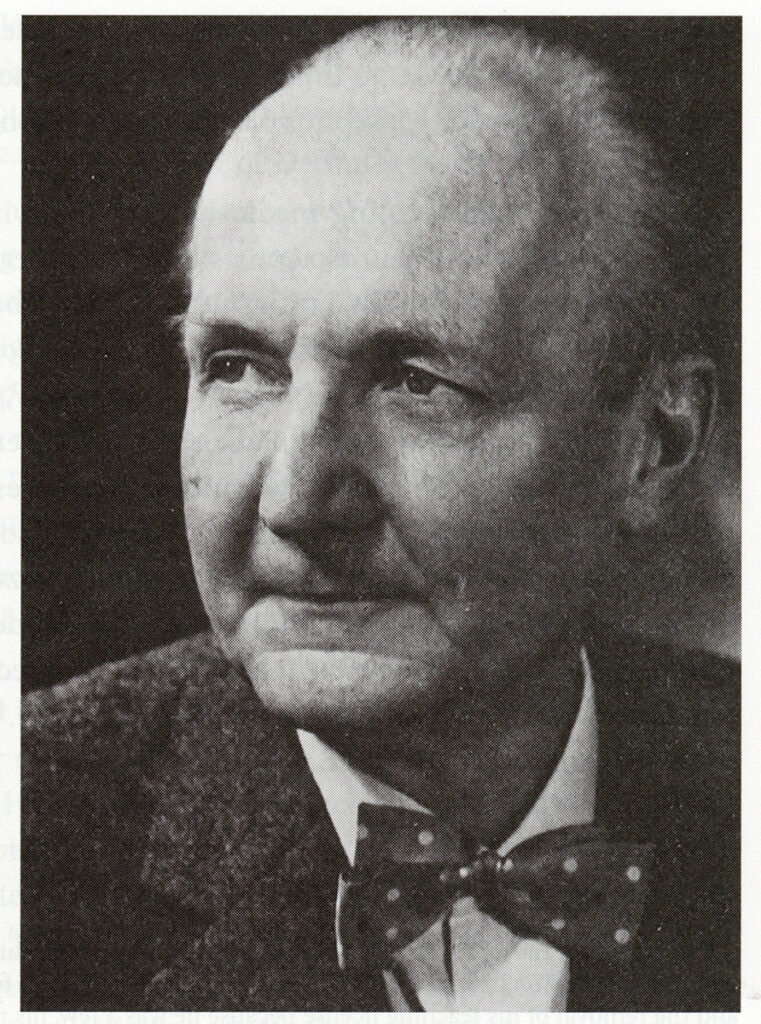
Hans Jacob, nach 1945.
Lawrence Zeidman: Brain Science under the Swastika. Ethical Violations, Resistance, and Victimization of Neuroscientists in Nazi Europe, Oxford 2020.
Am UKE nutzte der Gehirnforscher Hans Jacob die aus Lüneburg kommenden Organe für seine Forschungen. Er arbeitete dem »Reichsausschuss« zu. Eine Zusammenarbeit zwischen »Tötungs-« und Forschungseinrichtungen gab es mit vielen Gehirnforschern. Hans Heinze (Görden) und Julius Hallervorden (Berlin) waren sogar bei Krankenmorden dabei, um gleich nach Todeseintritt mit den Untersuchungen zu beginnen und Sammlungen anzulegen.
Das Krankenhaus in Hamburg gehört
zur Universität.
Die Ärzte im Krankenhaus machen
Hirn-Forschung.
Der Arzt Hans Jacob arbeitet dort und
forscht an Gehirnen.
Die Gehirne kommen aus Lüneburg.
Hans Jacob arbeitet für den Reichsausschuss
von den Nazis.
Darum bekommt er viele Gehirne
und andere Teile von Leichen.
Kinder-Fachabteilungen und Tötungs-Anstalten arbeiten mit den Forschern zusammen.
Die Mörder beliefern die Forscher.
Hans Heinze ist Forscher in Görden.
Julius Hallervorden ist Forscher in Berlin.
Sie sind sogar bei den Kranken-Morden dabei.
Sie untersuchen die Gehirne kurz nach dem Tod.
Die Forscher sammeln die Gehirne.
Das ist ein Foto von Hans Jacob.
Das Foto ist nach dem Jahr 1945 gemacht.
Von hohem wissenschaftlichem Interesse für Willi Baumert waren Kinder, bei denen er das »Hurler-Syndrom« vermutete. Das ist auch der Grund dafür, dass es zu Heinrich Herold aus Duingen besonders viele Gehirnschnitte gab.
Das Hurler-Syndrom ist eine Krankheit.
Der Arzt Willi Baumert forscht
zum Hurler-Syndrom
Er will wissen,
woher die Krankheit kommt.
Er will viel über die Krankheit wissen.
Heinrich Herold kommt aus Duingen.
Er hat die Krankheit Hurler-Syndrom.
Willi Baumert ermordet Heinrich Herold.
Dann nimmt Willi Baumert das Gehirn
aus dem Kopf von Heinrich Herold.
Er schneidet das Gehirn in dünne Scheiben.
So kann er es genau untersuchen.
Das ist ein Foto von Helmut Herold.
Er ist links vor dem Auto.
Neben ihm sind sein Cousin Helmut
und seine Schwester Irmgard.
Das Foto ist aus dem Jahr 1938.
Da ist Heinrich noch zu Hause.

Heinrich Herold, Helmut Sievers und Irmgard Herold (von links nach rechts), vor dem Elternhaus in Duingen, 1938.
Privatbesitz Holger Sievers.
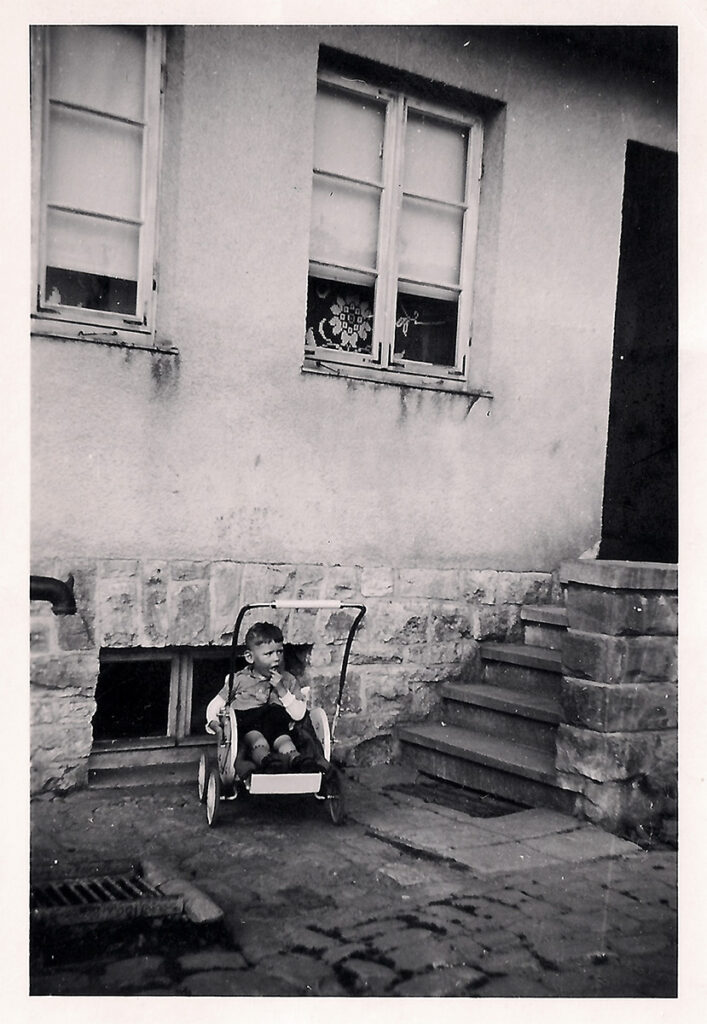
Privatbesitz Familie Schäfer.
Das ist das letzte Foto von Heinz Schäfer, aufgenommen im Herbst 1941. Wenige Wochen später wurde er in die Lüneburger »Kinderfachabteilung« eingewiesen und war kurz danach bereits tot. Die Eltern konnten es nicht glauben. Der Vater reiste nach Lüneburg und ließ den Sarg öffnen, um sich zu vergewissern. Der Kopf von Heinz‘ Leiche war verbunden. Die Familie konnte sich das nicht erklären, da Heinz offiziell an »Diphtherie u. katarrh. Lungenentzündung« gestorben war.
Das ist ein Foto von Heinz Schäfer
aus dem Jahr 1941.
Es ist das letzte Foto von Heinz.
Kurz danach kommt Heinz
in die Kinder-Fachabteilung nach Lüneburg.
Heinz wird dort ermordet.
Die Eltern können es nicht glauben.
Die Eltern wollen wissen:
Ist Heinz wirklich tot.
Darum reist der Vater nach Lüneburg.
Der Vater will in den Sarg von Heinz gucken.
Man öffnet den Sarg.
Heinz liegt im Sarg.
Er hat einen Verband um den Kopf.
Der Vater fragt:
Warum hat Heinz einen Verband?
Warum hat Heinz eine Verletzung am Kopf?
Die Familie versteht nicht,
warum Heinz einen Verband am Kopf hat
Denn die Familie denkt:
Heinz stirbt an einer Haut-Entzündung.
Da braucht er keinen Verband am Kopf.
Man verschwieg den Familien, dass die Gehirne entnommen worden waren. Über Heinz Schäfers Tod wurde in der Familie immer wieder gerätselt. 2012 konnten ihm im UKE eingelagerte Gehirn-Präparate zugeordnet werden. Die Familie wurde erstmals über sein wahres Schicksal aufgeklärt. Nach vielen Jahrzehnten erhielt sie Antwort auf die Frage, warum Heinz‘ Kopf verbunden gewesen war. Willi Baumert und Hans Jacob hatten sein Gehirn für ihre Forschungen benutzt.
Die Ärzte sagen der Familie nicht,
dass sie Heinz das Gehirn rausgeschnitten haben.
Die Familie weiß lange nicht Bescheid.
Erst im Jahr 2012 findet man Teile von Gehirnen
im Krankenhaus in Hamburg
Einige von den Teilen gehören zu Heinz.
Die Familie weiß jetzt die Wahrheit.
Die Familie weiß:
Heinz wird in der Nazi-Zeit ermordet.
Die Ärzte schneiden ihm das Gehirn raus.
Darum hat Heinz den Verband am Kopf.
Die Ärzte Hans Jacob und Willi Baumert haben alles aufgeschrieben über das Gehirn von Heinz.
Das sind die Mitschriften aus dem Jahr 1942.
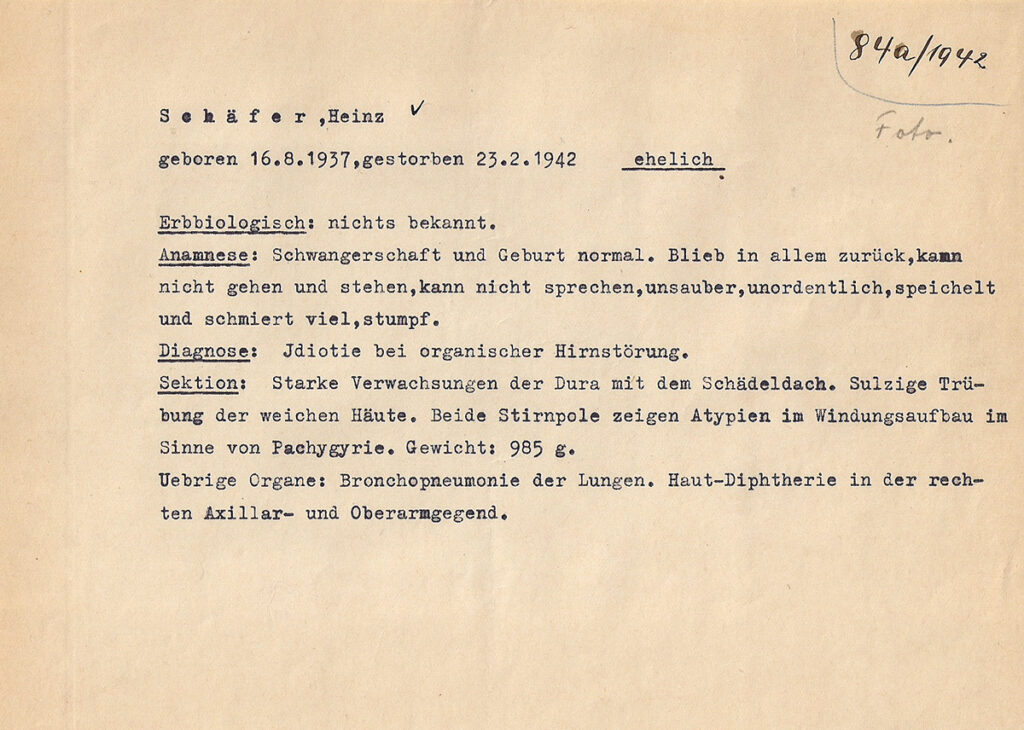
Mitschrift von Willi Baumert über die Untersuchung des Gehirns von Heinz Schäfer, 1942.
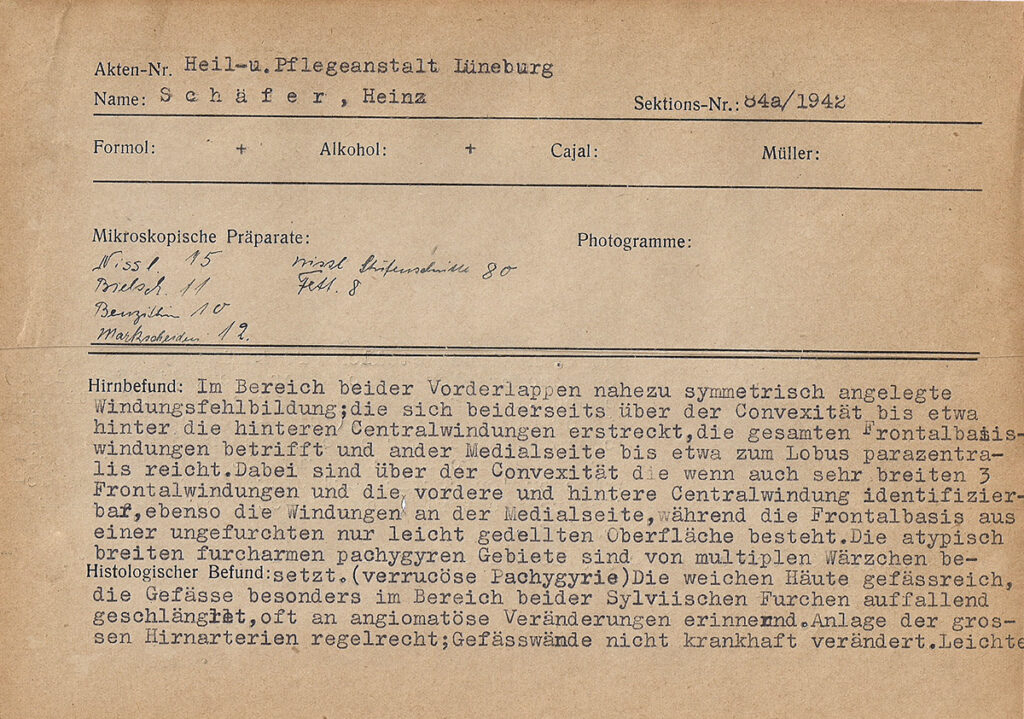
Erste Seite der Mitschrift von Hans Jacob über die Untersuchung des Gehirns von Heinz Schäfer, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, 1942.
Institut für Geschichte und Ethik der Medizin Hamburg.
In diesen Auszügen befinden sich schockierende Bilder. Sie zu zeigen, ist umstrittenIn diesen Auszügen befinden sich schockierende Bilder. Sie zu zeigen, ist umstritten.
Entscheiden Sie für sich, ob Sie den Auszug öffnen.
In dieser Schublade sind schlimme Fotos.
Die Fotos sind sehr grausam.
Einige Leute sagen: Es ist gut, die Bilder zu zeigen.
Einige Leute sagen:
Es ist schlecht, die Bilder zu zeigen.
Sie müssen selbst entscheiden,
ob Sie die Fotos ansehen oder nicht.

Wanne zur Leichenöffnung, etwa 1941.
ArEGL.
Im Oktober 2023 wurde im Keller von Haus 25, dem Standort der ehemaligen »Kinderfachabteilung«, diese Wanne gefunden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich um eine Sektionswanne. Spuren in den Kellerräumen von Haus 25 deuten darauf hin, dass die Leichen der Kinder und Jugendlichen nicht über das Anstaltsgelände in den damaligen offiziellen Raum für Leichenöffnungen gebracht, sondern vor Ort in Haus 25 geöffnet wurden.
Das ist ein Foto von einer Wanne.
Man findet diese Wanne im Oktober 2023
in der Anstalt in Lüneburg.
Die Wanne war im Keller von Haus 25.
Hier war in der Nazi-Zeit
die Kinder-Fachabteilung.
Darum glauben wir:
Diese Wanne war für Leichen.
In dieser Wanne hat man die Leichen aufgeschnitten.
Wir vermuten:
Im Keller von Haus 25 hat man Leichen aufgeschnitten.
Man hat hier die Leichen von den Kindern
aus Haus 25 aufgeschnitten.
Das sind problematische Bilder. Sie zeigen einen Jungen und ein Mädchen in großer Not und elendem Zustand. Es ist nicht bekannt, wer die beiden Kinder sind. Die Fotos nutzte Willi Baumert für seine »Forschung«. Es sind entwürdigende, grauenhafte Aufnahmen. Sie zeigen schonungslos die Brutalität und Unmenschlichkeit, die die Kinder in der Lüneburger »Kinderfachabteilung« erleben mussten. Nur deshalb zeigen wir sie.
Das sind Fotos von Kindern
in der Kinder-Fachabteilung in Lüneburg.
Die Fotos sind aus den Jahr 1942 und 1943.
Die Fotos sind sehr grausam.
Die Fotos zeigen:
• Die Kinder werden schlecht behandelt.
• Die Kinder haben keine Rechte.
• Die Kinder sind in großer Not.
• Die Kinder müssen leiden.
Die Menschen sollen wissen,
wie es in der Nazi-Zeit war.
Darum zeigen wir diese Fotos.
Wir wissen heute nicht:
Wer sind die Kinder.
Wir wissen nur:
Der Arzt Willi Baumert hat mit den Fotos geforscht.
Die Fotografin Ruth Supper hat die Fotos gemacht.
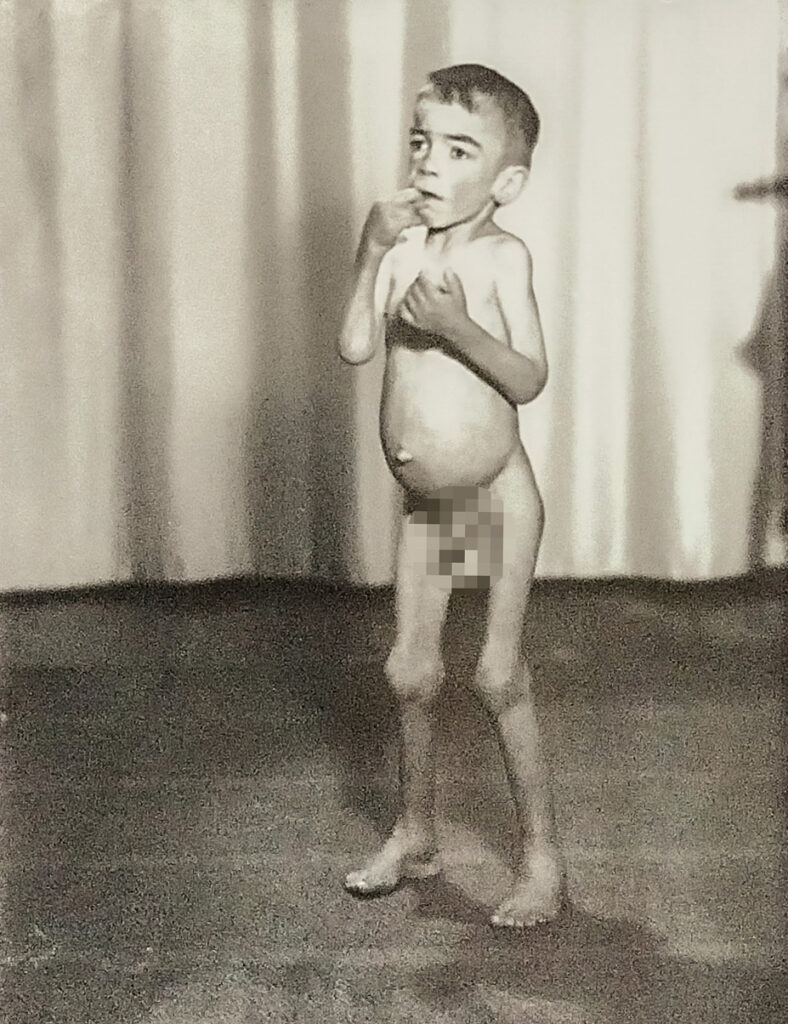
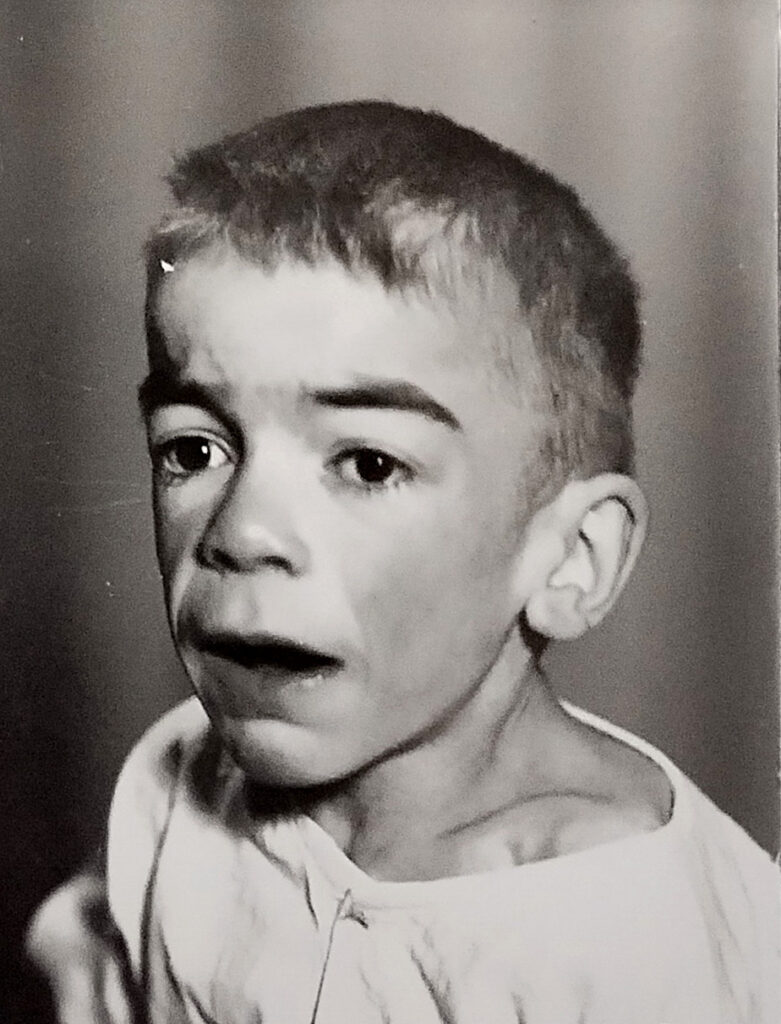
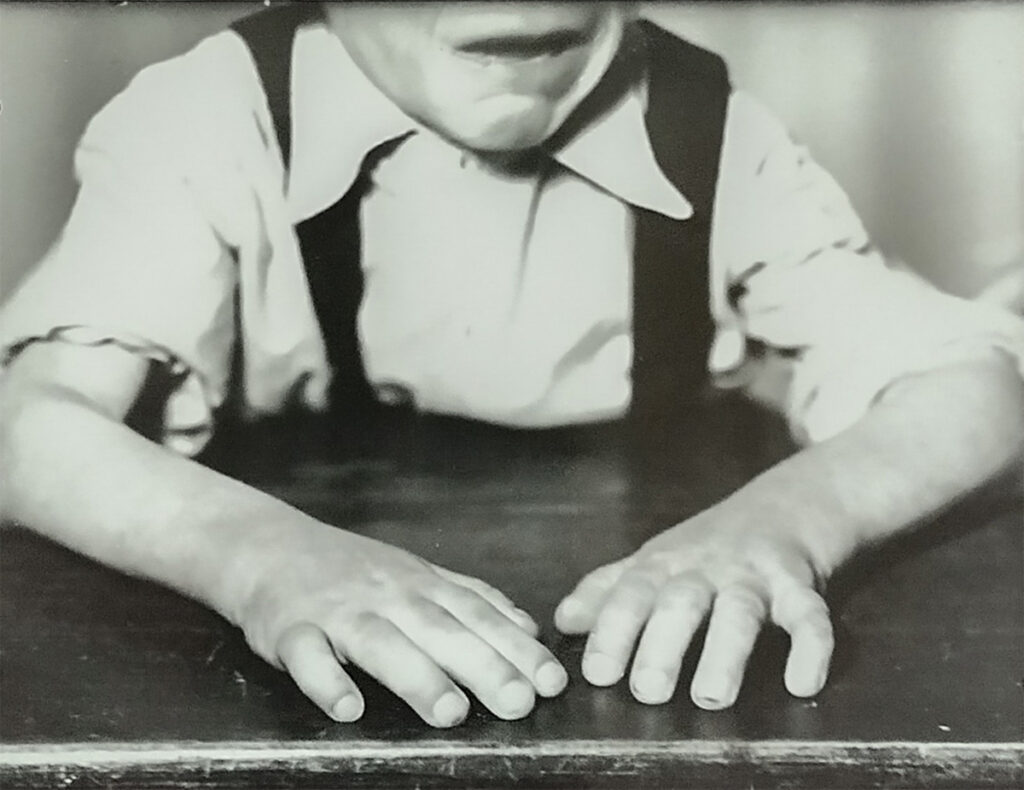
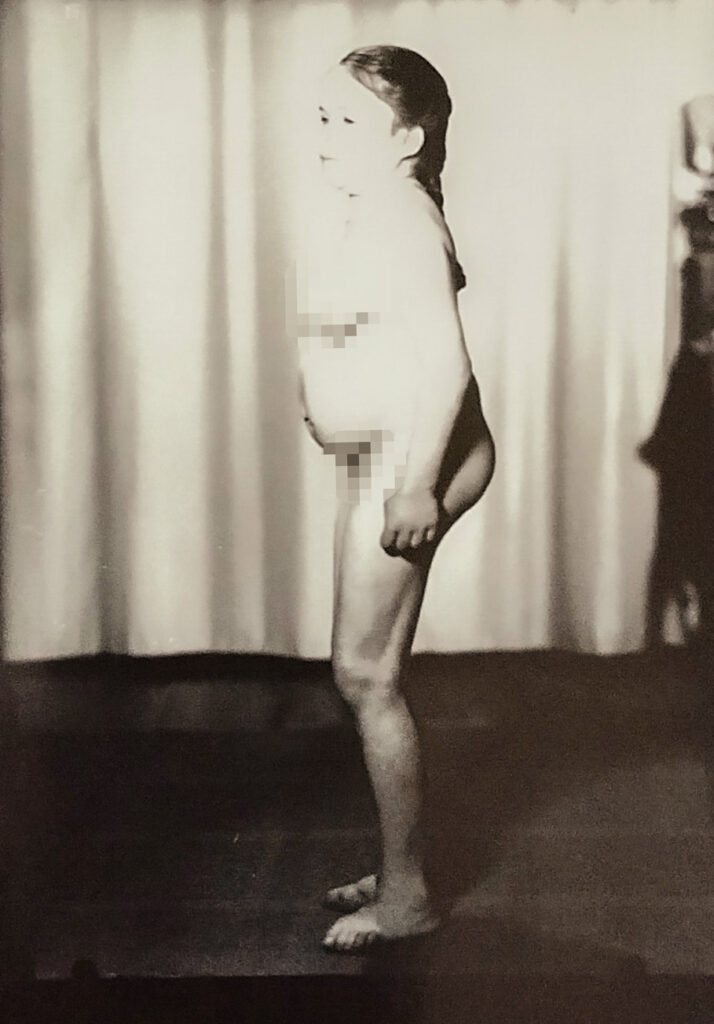

Fünf Aufnahmen von Kindern, aufgenommen in der »Kinderfachabteilung« Lüneburg, 1942/1943. Fotografin Ruth Supper.
ArEGL FB 2/34.
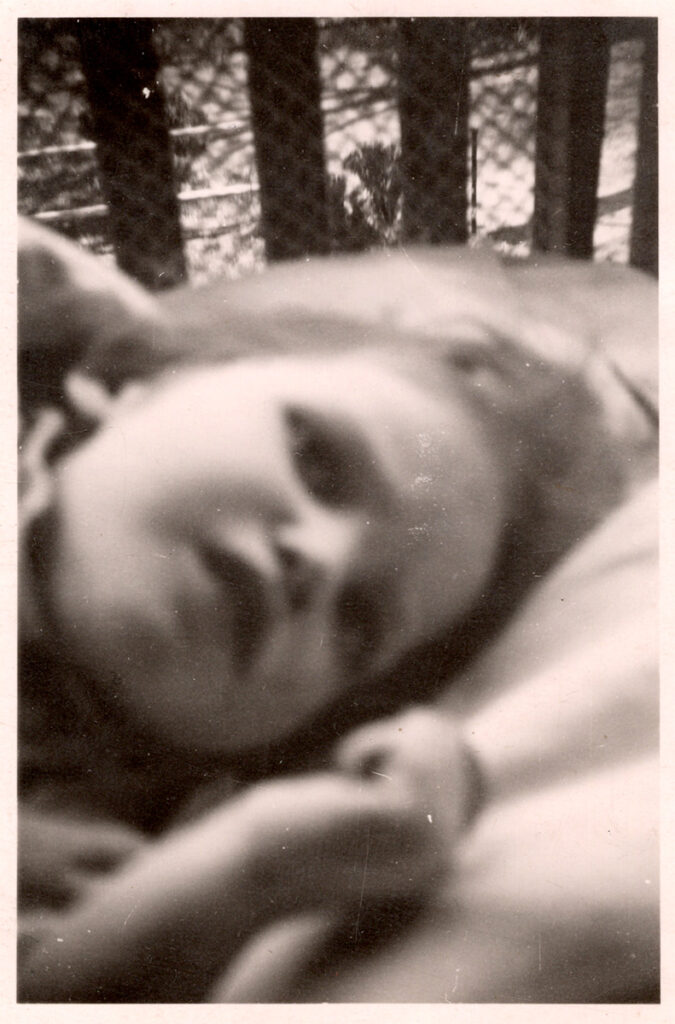
Inge Roxin, »Kinderfachabteilung« Lüneburg 1943.
Privatbesitz Sigrid Roxin.
Die Kinder wurden mit Krankheitserregern krank gemacht, um die Wirksamkeit des nicht zugelassenen Medikamentes »Eubasin« zu erforschen. Mariechen Petersen war nur während der Zeit, in der ihre Mutter sie besuchen konnte, nicht krank. Bei ihrer Nachbarin Inge Roxin wirkte »Eubasin«. Sie wurde gesund, bevor Willi Baumert sie ermordete.
Dieses Foto wurde in der »Kinderfachabteilung« aufgenommen. Das Bild zeigt, dass es Inge Roxin schlecht ging. An ihr wurden Menschenversuche durchgeführt. Das Bild ist problematisch. Aber es nicht zu zeigen, verharmlost das tatsächliche Elend. Von Mariechen Petersen gibt es kein Foto.
Es geht den Kindern in der Kinder-Fachabteilung
sehr schlecht.
Die Kinder werden schwer krank.
Die Ärzte machen die Kinder mit Absicht krank.
Dann probieren die Ärzte neue Medikamente
an den Kindern aus.
Diese Medikamente sind noch nicht erlaubt.
Die Ärzte machen Menschen-Versuche.
Sie machen auch Versuche
mit Mariechen Petersen und Inge Roxin.
Das ist ein Foto von Inge Roxin aus dem Jahr 1943.
Sie ist in der Kinder-Fachabteilung in Lüneburg.
Die Ärzte machen Versuche mit ihr:
Sie bekommt ein verbotenes Medikament.
Das Foto zeigt:
Inge Roxin geht es sehr schlecht.
Dann bekommt sie das Medikament.
Sie überlebt und es geht ihr besser.
Aber dann wird sie von Willi Baumert ermordet.
Das Foto von Inge Roxin ist nicht schön.
Aber wir zeigen es trotzdem.
Jeder soll sehen, wie schlimm es damals war.
Es ist ungewiss, ob es in der Lüneburger »Kinderfachabteilung« auch Versuche mit Impfstoffen gegen Tuberkulose, Scharlach oder andere Erkrankungen gegeben hat. Im Gegensatz zur Behandlung erwachsener Erkrankter, insbesondere in der sogenannten »Ausländersammelstelle«, gibt es für Kinder und Jugendliche bisher keinen Beleg dafür.
Es gibt viele Menschen-Versuche in der Anstalt
in Lüneburg in der Nazi-Zeit.
Vielleicht testet man Impfstoffe gegen Scharlach
oder Tuberkulose in der Kinder-Fach-Abteilung.
Das ist aber nicht sicher.
Es gibt keine Beweise dafür.
An der Forschung in der »Kinderfachabteilung« waren viele Beschäftigte aus der Pflege, aber auch aus der Verwaltung und nichtpflegerischen Bereichen der Lüneburger Heil- und Pflegeanstalt beteiligt. Sie alle unternahmen nichts, um das Kindersterben zu verhindern oder die Situation der Kinder zu verbessern. Sie können daher als Helferinnen und Helfer angesehen werden.
Viele machen mit bei der Forschung
in der Kinder-Fachabteilung.
Es sind nicht nur Pfleger.
Es sind auch
• Menschen aus dem Büro.
• Fahrer.
• Putzfrauen.
Sie alle helfen den Ärzten und gucken zu.
Sie tun nichts.
Sie helfen den Kindern nicht.
Sie helfen den Mördern.
Im Raum ENTSCHEIDEN gibt es mehr Infos
zu dem Thema.
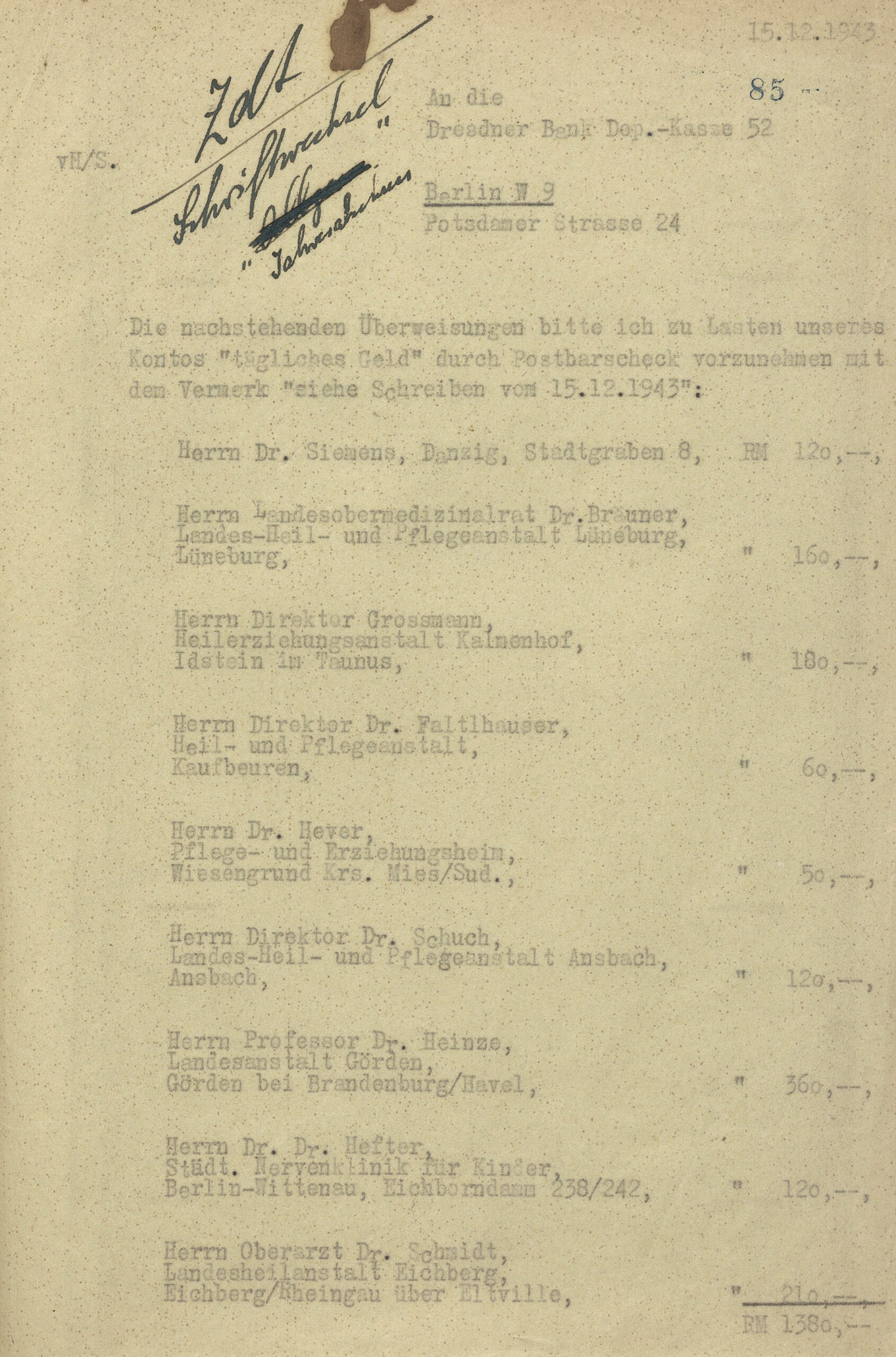
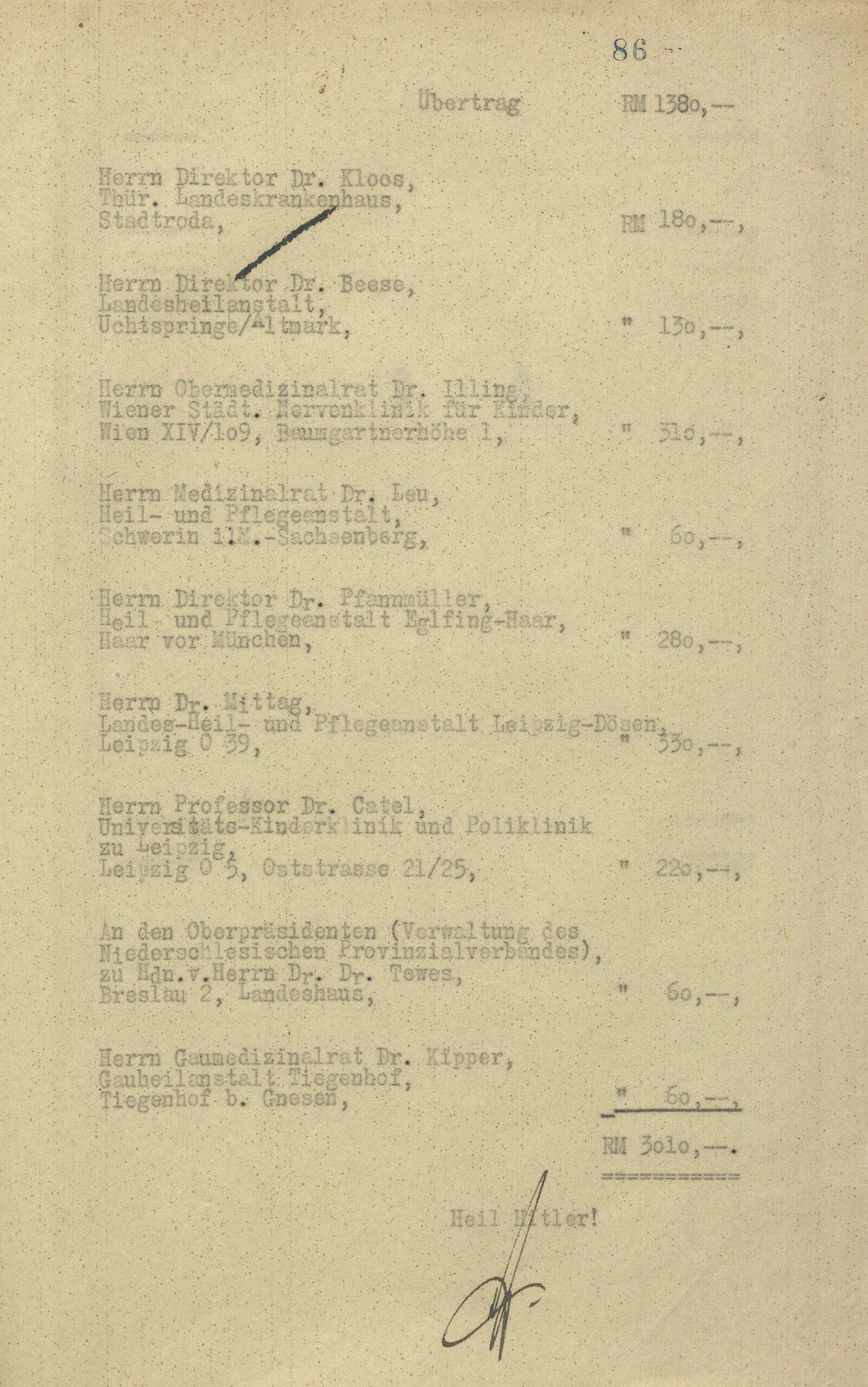
Brief an die Dresdner Bank mit der Anweisung über die Auszahlung von »Sonderzuwendungen« vom 15.12.1943.
BArch NS 51/227.
Für das Morden in der »Kinderfachabteilung« erhielten die Beteiligten und Mithelferinnen »Sonderzuwendungen« als Belohnung. Auf dieser Liste ist erkennbar, dass die »Kinderfachabteilung« Görden den höchsten Betrag für »Sonderzuwendungen« erhielt, weil es dort 1943 besonders viele Beteiligte und Mithelferinnen an der »Kinder-Euthanasie« gab. Die Liste führt nicht alle »Kinderfachabteilungen« auf, in denen in diesem Jahr Kinder und Jugendliche ermordet wurden.
In der Nazi-Zeit gibt es extra Geld
für den Kinder-Mord
Alle Mitarbeiter bekommen extra Geld,
wenn sie beim Kinder-Mord mitmachen.
Das extra Geld gibt es immer zu Weihnachten.
Das ist eine Liste aus dem Jahr 1943
mit Kinder-Fachabteilungen.
Die Liste zeigt:
Wieviel extra Geld bekommt die Kinder-Fachabteilung von einer Anstalt.
Die Kinder-Fachabteilung in Görden steht ganz oben auf der Liste.
Dort haben sehr viele Menschen
beim Kinder-Mord mitgemacht.
Das ist ein Brief an die Dresdner Bank.
Die Bank soll das extra Geld an die Anstalten auszahlen.
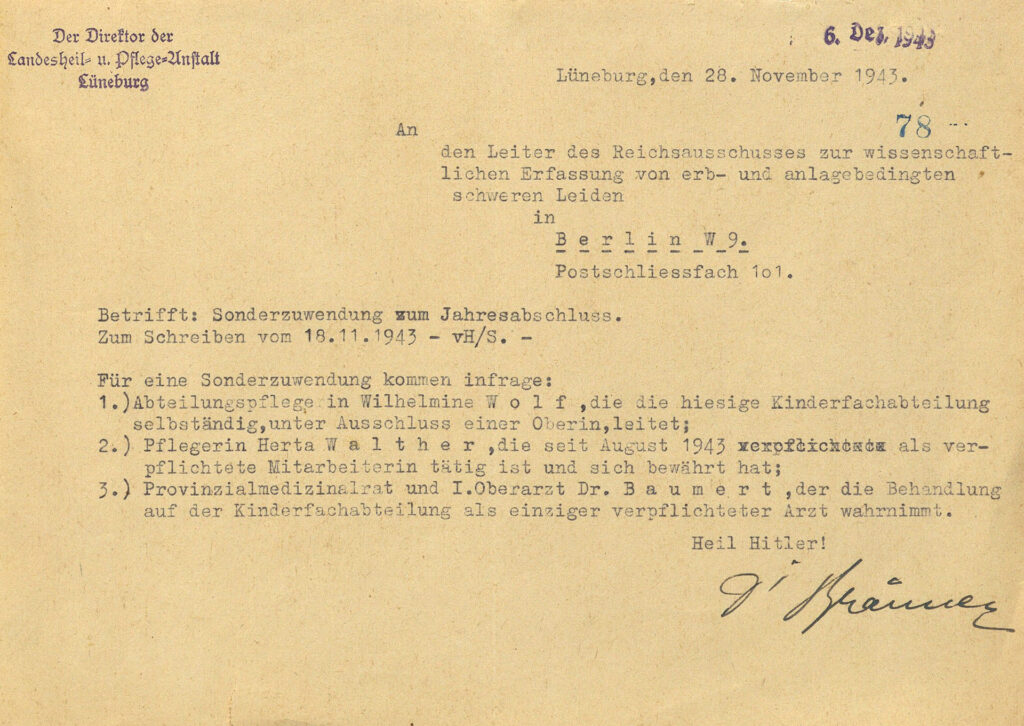
Brief von Max Bräuner an den »Reichsausschuss« vom 28.11.1943.
BArch NS 51/227.
Die Beschäftigten der Lüneburger »Kinderfachabteilung« erhielten 1941 keine »Sonderzuwendungen«. 1942 wurden den Pflegerinnen Wilhelmine Wolf und Dora Vollbrecht jeweils 30 Reichsmark extra ausgezahlt. Für das Jahr 1943 empfahl Max Bräuner die Pflegerinnen Wilhelmine Wolf und Hertha Walther sowie seinen Oberarzt Willi Baumert für zusätzliche Zahlungen. Als Arzt wurde dieser mit 100 Reichsmark belohnt, sodass Lüneburg 1943 insgesamt 160 Reichsmark vom »Reichsausschuss« erhielt.
Das ist ein Brief von dem Arzt Max Bräuner
an den Reichsausschuss.
Max Bräuner schreibt:
Im Jahr 1942 soll es extra Geld geben
für die Pflegerinnen Wilhelmine Wolf und
Dora Vollbrecht.
Im Jahr 1943 soll es extra Geld geben
für die Pflegerinnen Wilhelmine Wolf und
Hertha Walther.
Der Reichsausschuss bezahlt das extra Geld:
Jede Pflegerin bekommen 30 Reichsmark.
Der Arzt Max Bräuner bekommt 100 Reichsmark.
Alle Briefe zwAlle Briefe zwischen dem »Reichsauschuss« und der Anstalt, die Gutachten, die Einträge bei Visiten und die Mitschriften der Leichenöffnungen wurden von der Sekretärin Karola Bierwisch (geb. Kleim) geschrieben. Sie war nicht nur als Sekretärin des Ärztlichen Direktors Max Bräuner, sondern als seine Assistentin bei der tödlichen Forschung beteiligt. Deshalb erhielt sie für das Jahr 1944 ebenfalls eine »Sonderzuwendung« vom »Reichsausschuss«.
Max Bräuner hat eine Büro-Mitarbeiterin.
Sie heißt: Karola Bierwisch.
In der Nazi-Zeit heißt sie: Karola Kleim.
Sie schreibt seine Briefe.
Sie ist bei den Untersuchungen
von den Kindern dabei.
Sie ist die wichtigste Hilfe von Max Bräuner.
Sie macht sogar beim Aufschneiden
von den Leichen mit.
Sie bekommt extra Geld, weil sie so viel hilft.
Das extra Geld kommt vom Reichsausschuss.
Karola Kleim ist eine Ausnahme.
Denn sonst bekommen nur Pflegerinnen und Ärzte extra Geld.
Sie bekommen auch extra Geld,
wenn sie Kinder mit Medikamenten ermorden.
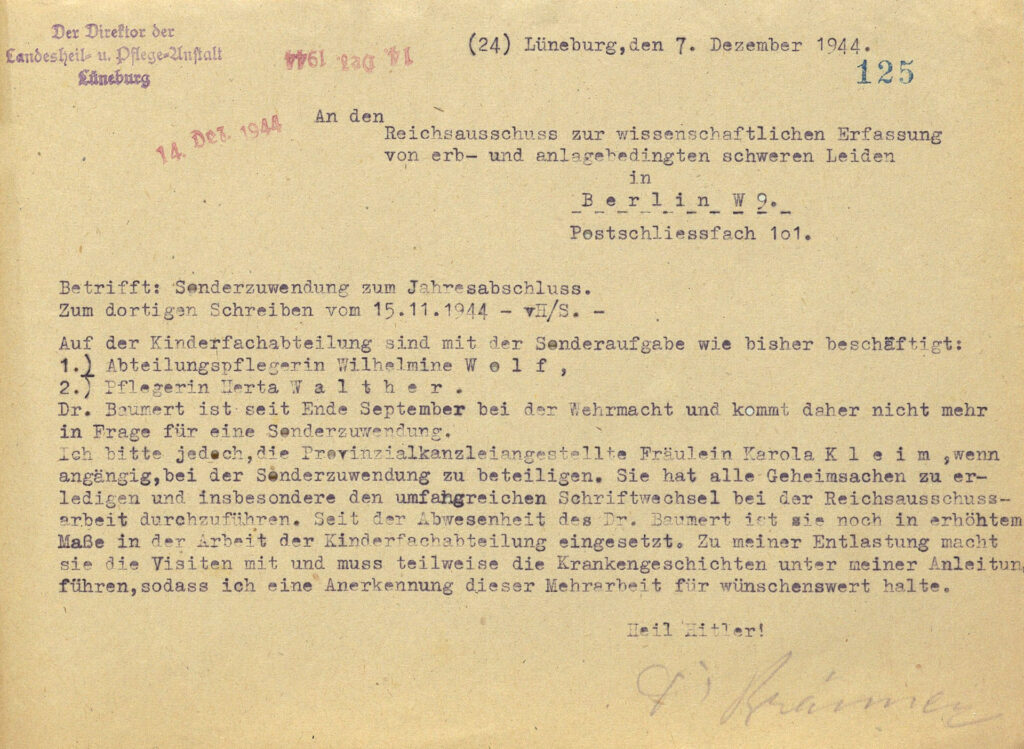
Brief von Max Bräuner an den »Reichsausschuss« vom 7.12.1944.
BArch NS 51/227.
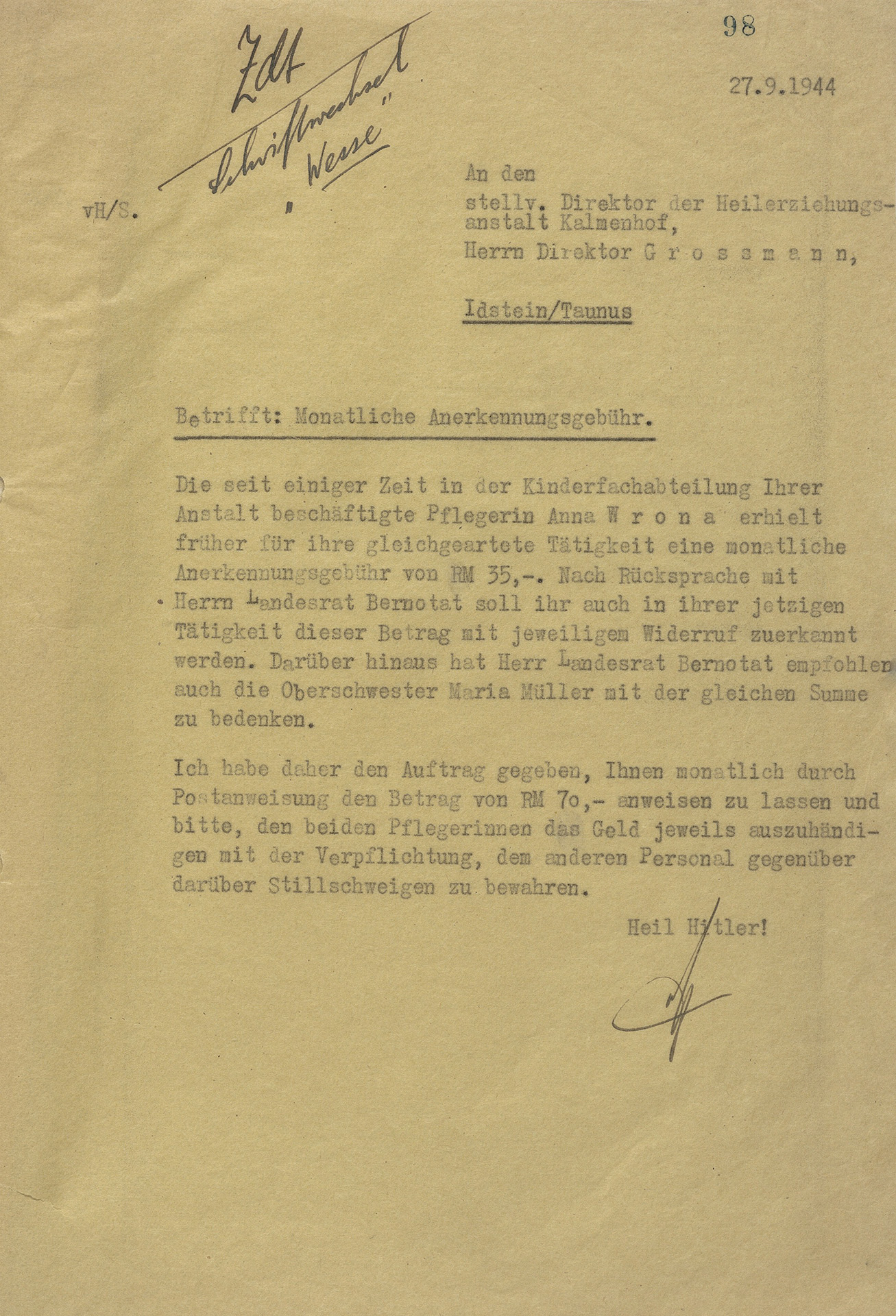
Brief des »Reichsausschusses« an die Heil- und Pflegeanstalt Kalmenhof vom 27.9.1944.
BArch NS 51/227.
Im Jahr 1944 erhielten einzelne Pflegekräfte eine monatliche Zulage in Höhe von 35 Reichsmark für ihre Beteiligung am Krankenmord. Auch die Lüneburger Pflegekräfte erhielten eine solche Zulage. Sie sollte die Loyalität stärken und die Motivation erhöhen.
Einige Pfleger bekommen nicht nur das extra Geld
zu Weihnachten.
Sie bekommen ab dem Jahr 1944 auch mehr Gehalt.
Sie bekommen 35 Reichsmark im Monat mehr.
Sie bekommen mehr Gehalt,
damit sie weitermachen mit den Kinder-Morden.
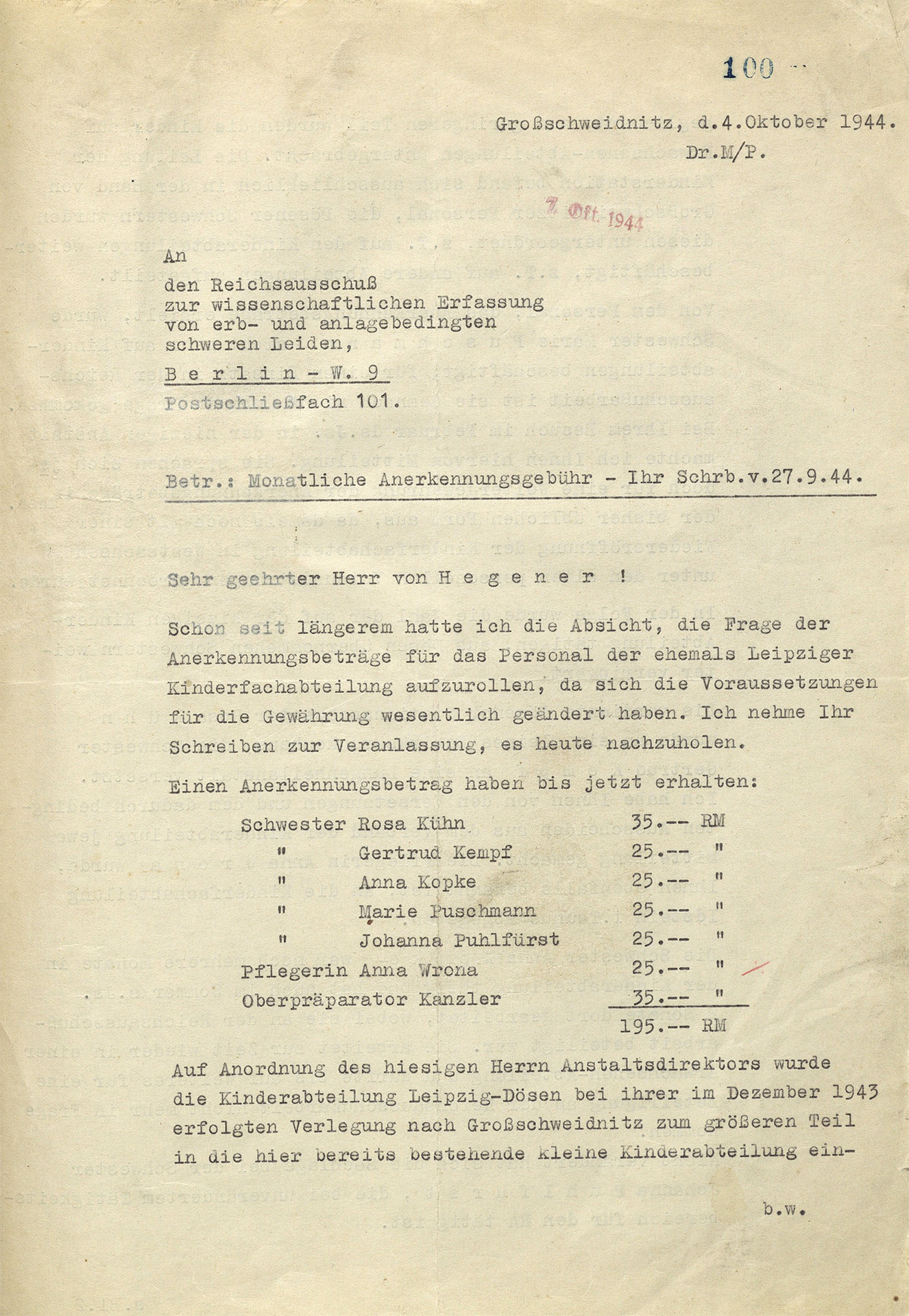
Brief der Heil- und Pflegeanstalt Großschweidnitz an den Reichsausschuss vom 4.10.1944.
BArch NS 51/227.
Wer sich in der sogenannten »Reichsausschussarbeit« besonders verdient gemacht hatte, erhielt einen Orden. Denjenigen wurde das »Ehrenzeichen für deutsche Volkspflege« verliehen. Die von ihnen verübten Morde wurden auf diese Weise »wertgeschätzt«.
Einige Pfleger strengen sich besonders an.
Sie wollen das Morden besonders gut machen.
Dafür bekommen sie eine Belohnung.
Sie bekommen einen Orden.
Der Orden heißt:
Ein Ehrenzeichen für deutsche Volkspflege.
Der Orden ist für die Kinder-Morde.
Bei den Leichenöffnungen in der »Kinderfachabteilung« Lüneburg halfen die Pfleger August Gebhardt und Ernst Meier. Gebhardt war seit 1912 Pflegekraft und ab 1938 für die Öffnung und Wiederverschließung der Körper zuständig. Obwohl die Mutter des »T4«-Opfers Paul Hausen ihm sagte, sie denke, ihr Sohn sei ermordet worden, ahnte Gebhardt nicht, dass die vielen von ihm zu bearbeitenden Kinderleichen ebenfalls Opfer des Krankenmordes waren.
August Gebhardt und Ernst Meier sind Pfleger
in der Anstalt in Lüneburg.
Sie helfen beim Aufschneiden von Kinder-Leichen.
August Gebhardt kennt die Mutter von Paul Hausen.
Das Kind Paul Hausen stirbt beim Kranken-Mord.
Die Mutter von Paul Hausen denkt:
Mein Sohn wurde ermordet.
Das erzählt sie dem Pfleger August Gebhardt.
Aber August Gebhardt denkt trotzdem:
Alle Kinder sind ohne Gewalt gestorben.
Sie sind an Krankheiten gestorben
Aber das stimmt nicht.
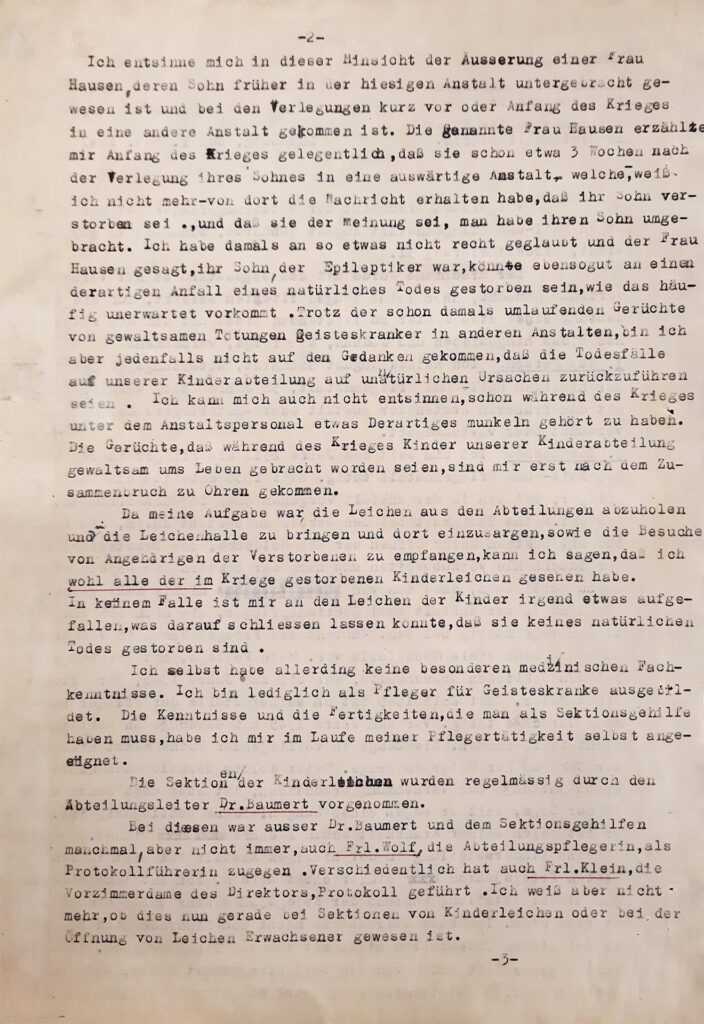
Auszug aus der Mitschrift der Vernehmung von August Gebhardt vom 1.11.1947.
NLA Hannover Nds. 721 Lüneburg Acc. 8/98 Nr. 3.
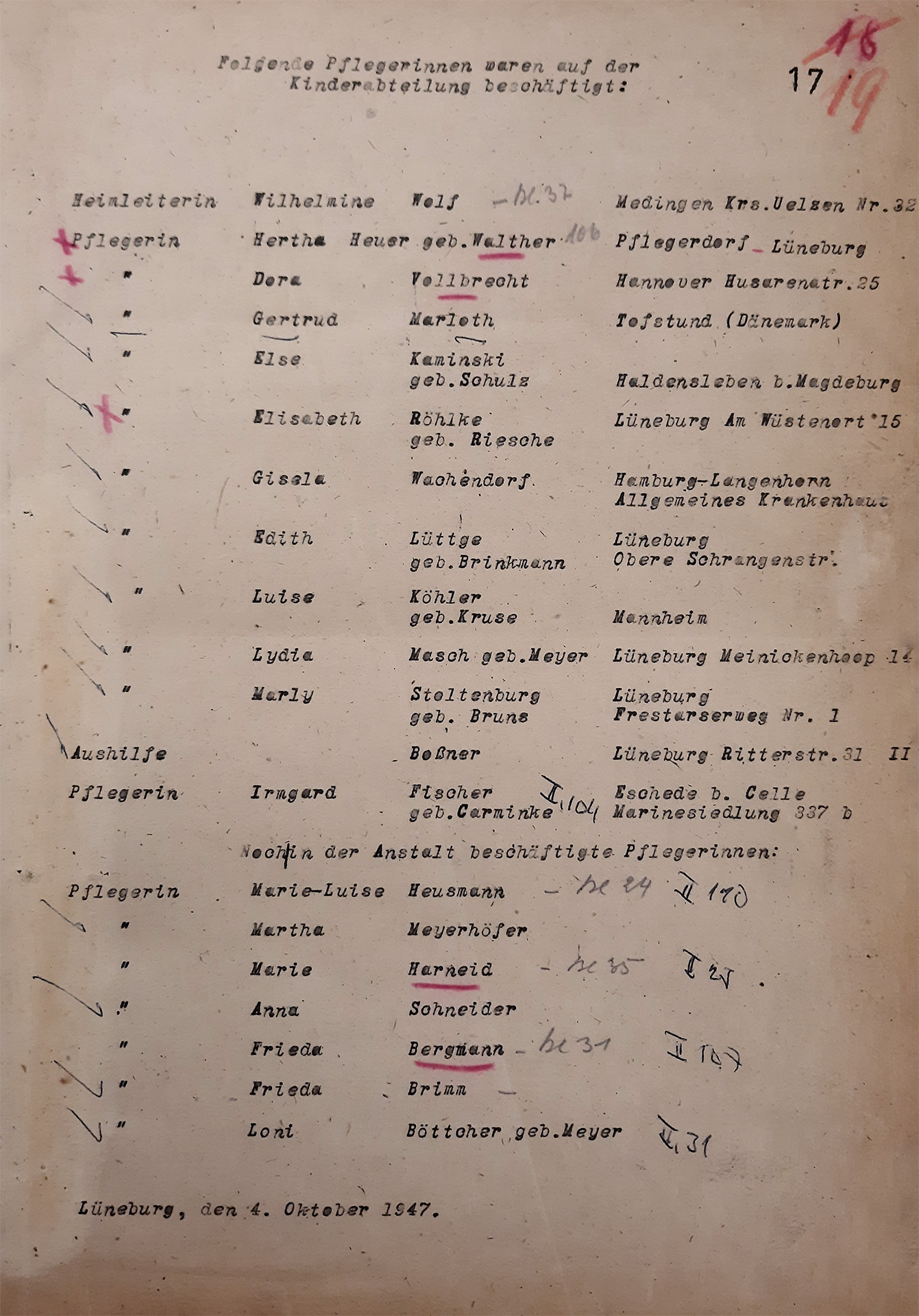
Übersicht der Pflegekräfte in der »Kinderfachabteilung« vom 4.10.1947.
NLA Hannover Nds. 721 Lüneburg Acc. 8/98 Nr. 3.
Die Kinder und Jugendlichen wurden von insgesamt 21 Pflegekräften in drei Schichten betreut und gepflegt. Neben den drei Pflegekräften Wilhelmine Wolf (Oberpflegerin), Ingeborg Weber (sie nahm sich das Leben, daher steht sie nicht auf der Liste) und Dora Vollbrecht, gab es demnach viele weitere Pflegekräfte, die die Kinder und Jugendlichen vernachlässigten und mangelhaft versorgten, ihnen beim Sterben tatenlos zuschauten.
Das ist eine Liste von allen Pflegern
in der Kinder-Fachabteilung.
Die Liste ist aus dem Jahr 1947.
Auf der Liste stehen 20 Pfleger.
Aber es gibt 21 Pfleger.
Die Pflegerin Ingeborg Weber steht nicht mehr
auf der Liste.
Sie hat sich in der Nazi-Zeit selbst getötet.
Sehr viele Pfleger haben mitgemacht
beim Kinder-Mord.
»In der Anstalt habe ich für etwa 130 Kinder 7 Pflegerinnen gleichzeitig im Dienst. Mehr zu stellen ist mit Blick auf die kriegsbedingten Personalschwierigkeiten unmöglich; man fragt sich auch, ob bei der Wertlosigkeit dieses Menschenmaterials in der augenblicklichen Kriegszeit mehr verantwortet werden könne.«
Auszug aus einem Brief von Max Bräuner an das Staatliche Gesundheitsamt Wittmund vom 17.10.1942.
NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 Nr. 145, S. 2.
In der »Kinderfachabteilung« Lüneburg gab es 35 Geschwisterkinder aus 15 Familien. Bis zu vier Kinder einer Familie wurden eingewiesen. Manchmal wurden den Eltern alle Kinder genommen. Auch nach dem Krieg kehrten viele Kinder nicht nach Hause zurück. Von den Geschwisterkindern war es nur ein einziges, das seine Eltern wiedersah. Die Jugendlichen wurden ab 1945 an die Jugendfürsorge übergeben. Viele der Überlebenden blieben noch bis in die 1970er-Jahre Bewohnerin und Bewohner der Anstalt.
In der Kinder-Fachabteilung in Lüneburg gibt es
35 Geschwister-Kinder.
Sie sind aus 15 Familien.
Manchmal werden alle Kinder
aus einer Familie ermordet.
Dann ist der Zweite Weltkrieg vorbei.
Nur ein Kind darf wieder nach Hause.
Die anderen Kinder bleiben noch viele Jahre
in der Anstalt
Einige Kinder kommen in ein Jugendheim.
Aber sie kommen nicht zurück nach Hause.
ERIKA (1936 – 1944) UND MARGRET BUHLRICH (1941 – 1945)
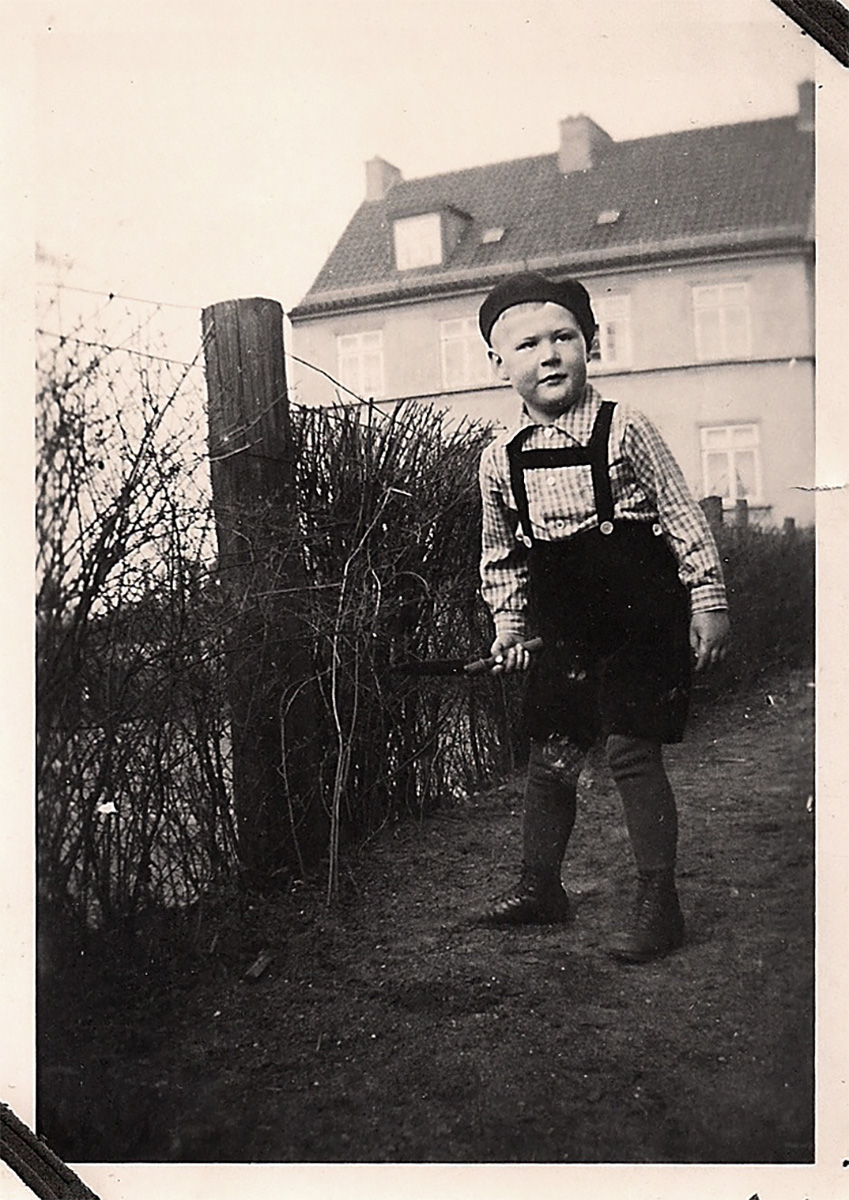
Hans Buhlrich, 1936.
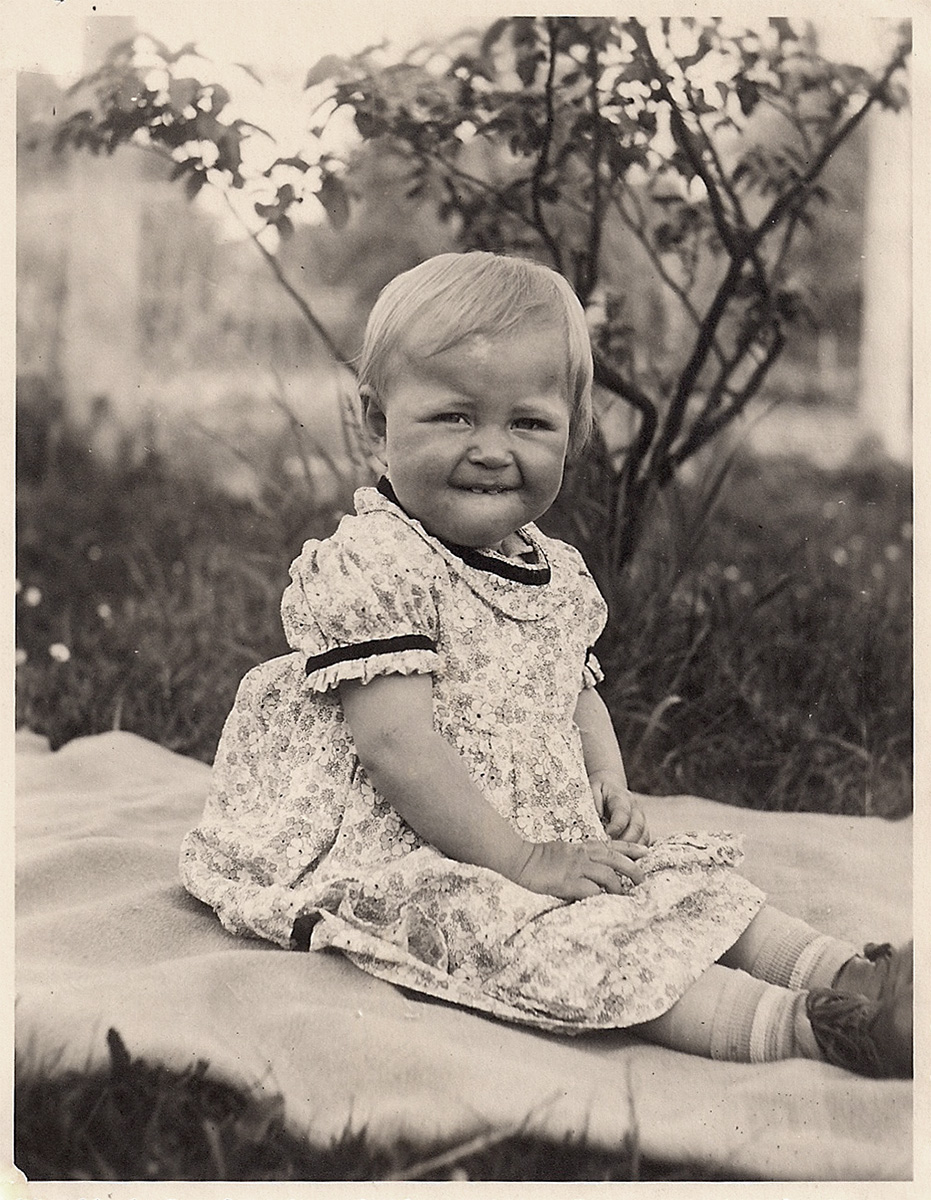
Erika Buhlrich, etwa 1937.
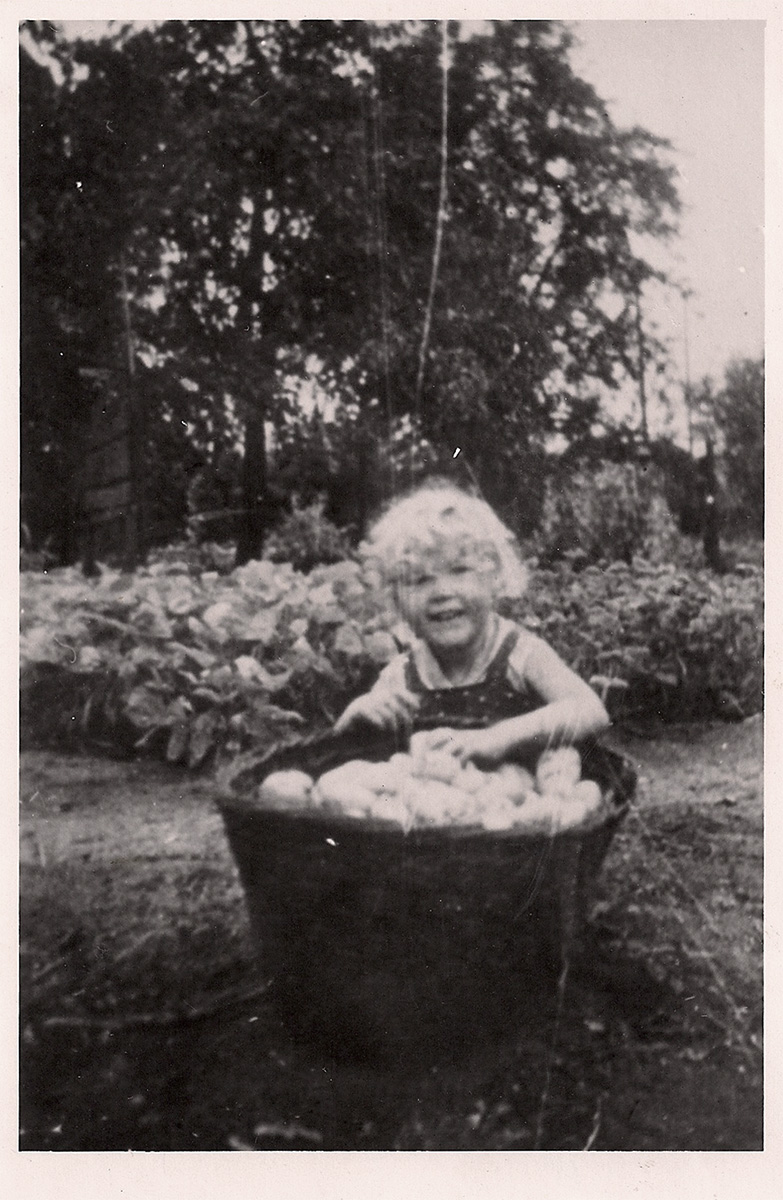
Margret Buhlrich, etwa Sommer 1944.
Privatbesitz Friedrich Buhlrich.
Die Geschwister Buhlrich aus Bremen kamen 1944 in die »Kinderfachabteilung« Lüneburg. Ihr Bruder Hans (1932 – 1942) war bereits 1942 in Kutzenberg (Bayern) gestorben. Er war nach wenigen Tagen aus dem Gertrudenheim bei Bremen evakuiert worden. Die Schwestern wurden rund zwei Jahre später ermordet, um an ihren Gehirnen zu untersuchen, ob eine krankhafte Veranlagung vorläge und die Mutter besser kein viertes Kind bekommen solle. Sie waren bei den Bombardierungen im Luftschutzraum von Nachbarn als störend empfunden worden. Die Mutter war sehr daran interessiert herauszufinden, warum ihr Sohn Hans einen lahmen Arm und ihre beiden Mädchen eine Entwicklungsverzögerung hatten. Um die Ursache herauszufinden starb erst Erika, dann auch Margret. Nachdem die Eltern erfuhren, dass Erika eine Hirnhautentzündung gehabt haben musste, jedoch die Herkunft der anderen Beeinträchtigungen unklar blieb, entschieden die Buhlrichs, kein weiteres Kind zu bekommen. Stattdessen adoptierten sie ein Kind, das aus einer Beziehung einer Deutschen und eines polnischen Zwangsarbeiters hervorgegangen war. Die Existenz von drei leiblichen Geschwistern blieb Friedrich Buhlrich bis zum Tod seiner Adoptiveltern unbekannt.
ERIKA UND MARGRET BUHLRICH
Erika und Margret Buhlrich kommen aus Bremen.
Sie haben einen kranken Bruder.
Er heißt: Hans.
Hans stirbt in Bayern in einem Heim in Kutzenberg.
Die Schwestern von Hans müssen in die Kinder-Fachabteilung in Lüneburg.
Das passiert 2 Jahre nach dem Tod von Hans.
Sie werden ermordet,
damit die Ärzte ihre Gehirne untersuchen können.
Die Ärzte wollen wissen:
Haben die Schwestern die gleiche Krankheit
wie Hans?
Haben die Kinder eine Erbkrankheit von der Mutter? Die Ärzte wollen dann entscheiden,
ob die Mutter ein viertes Kind bekommen darf.
Die Mutter will keine eigenen Kinder mehr.
Sie hat Angst, dass dieses Kind auch krank ist.
Aber die Mutter und der Vater adoptieren ein Kind.
Das Kind heißt Friedrich.
Die Eltern sagen Friedrich nicht,
dass sie vorher schon 3 Kinder hatten.
Das sind 3 Fotos:
Ein Foto von Hans Buhlrich aus dem Jahr 1936.
Ein Foto von Erika Buhlrich aus dem Jahr 1937.
Ein Foto von Margret Buhlrich aus dem Jahr 1944.
Die Kinder wurden Zeugen des Mordes und sahen ihren Geschwistern beim Sterben zu. So war es auch bei den Köhler-Zwillingen. Herberts Gesundheitszustand verschlechterte sich, im Januar 1945 wog der inzwischen 16-Jährige nur noch 28,5 kg. Er starb am 22. März 1945. Sein Zwillingsbruder Willi war bei ihm. Ihn traf der Verlust hart. Danach arbeitete der Bruder fleißig, sorgte dafür, dass es keine Klagen mehr gab. Er hatte begriffen, dass er nur so überleben konnte.
Einige Kinder müssen zusehen,
wie ihre Geschwister ermordet werden.
So ist es bei den Zwillingen Herbert und Willi Köhler.
Herbert verhungert.
Er bekommt nicht genug zu essen.
Er stirbt.
Sein Bruder Willi muss zusehen.
Er kann Herbert nicht helfen.
Willi ist sehr traurig über Herberts Tod.
Willi nimmt sich vor:
Jetzt arbeite ich viel.
Jetzt mache ich alles richtig.
Nur so kann ich überleben.
Das ist ein Teil von der Kranken-Geschichte
von Willi Köhler.
Darin steht:
Willi Köhler trauert um seinen Bruder.
Er vermisst seinen Bruder sehr.
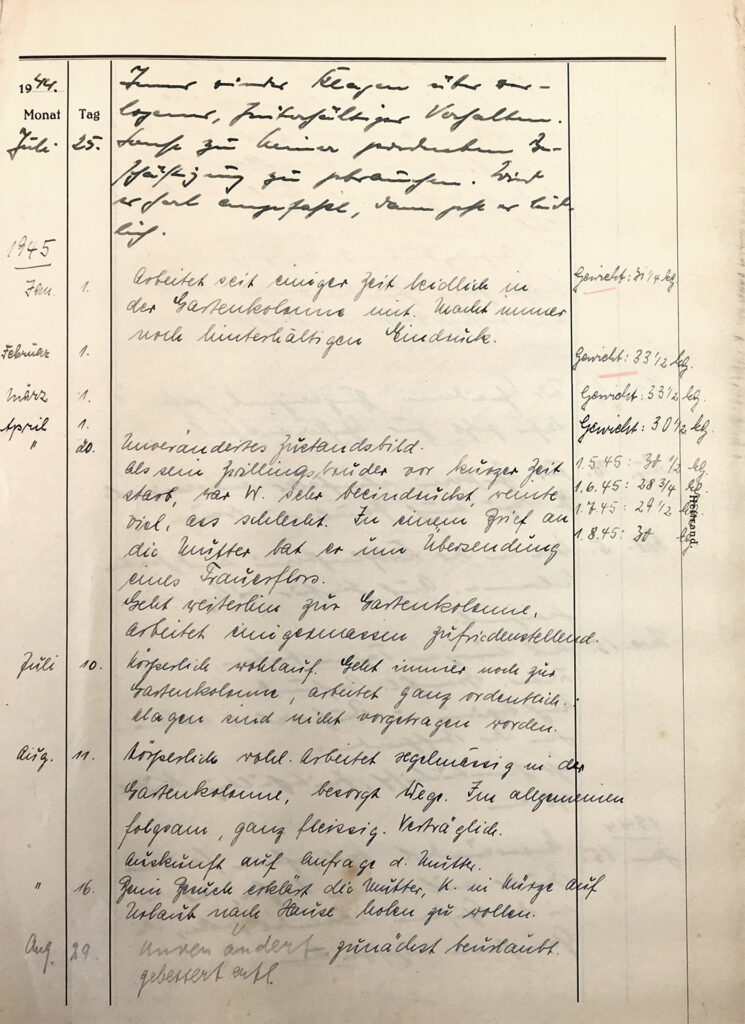
Auszug aus der Krankengeschichte von Willi Köhler.
NLA Hannover Nds. 330 Lüneburg Acc. 2004/134 Nr. 00416.
»Als sein Zwillingsbruder vor kurzer Zeit starb, war W. sehr beeindruckt, weinte viel, ass schlecht. Zu einem Brief an die Mutter bat er um einen Trauerflors.«
Auszug aus der Krankengeschichte von Willi Köhler.
NLA Hannover Nds. 330 Lüneburg Acc. 2004/134 Nr. 00416.
Das ist aus der Kranken-Geschichte von Willi Köhler.
Darin steht:
Willi Köhler ist traurig über seinen toten Bruder.
Er isst nicht mehr.
Er weint viel.
Er will eine schwarze Schleife
für einen Brief für seine Mutter haben.
Dann können alle sehen: Herbert ist tot.
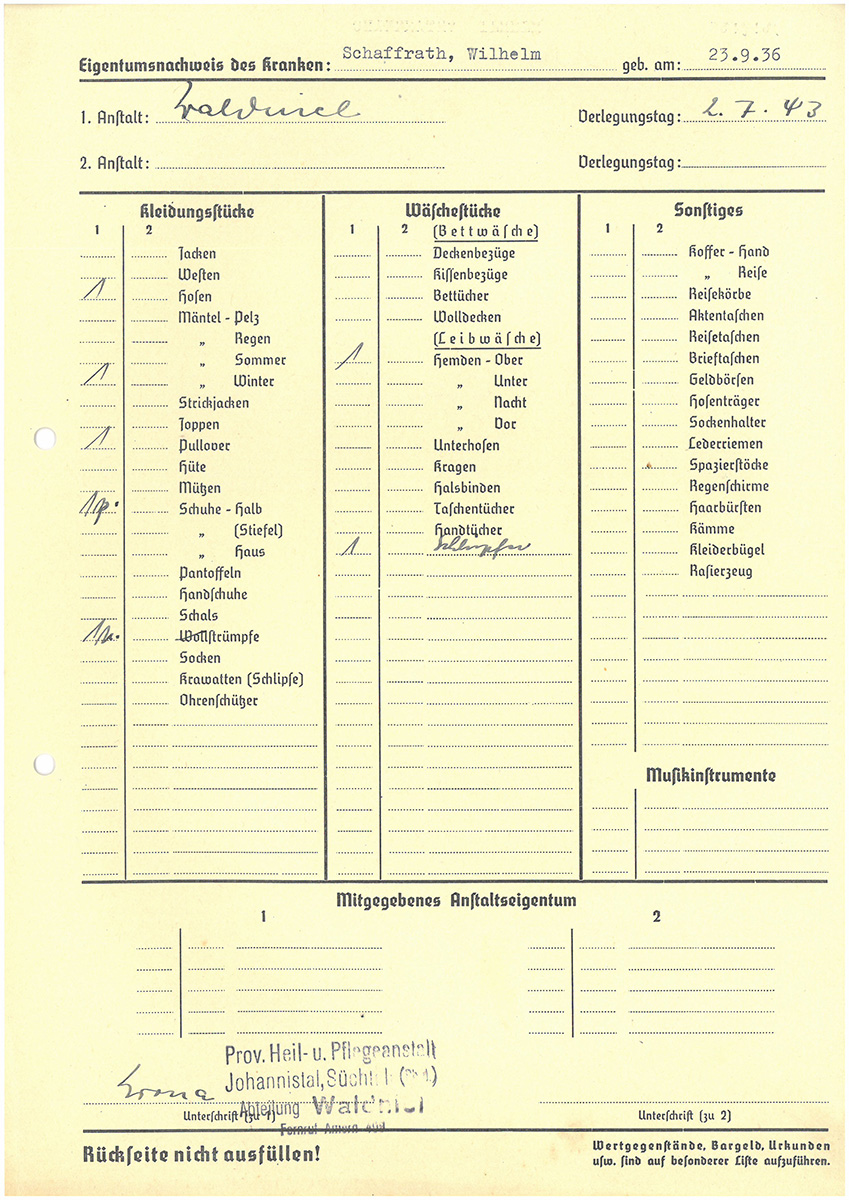
Auszug aus der Krankenakte, Sachenliste von Wilhelm Schaffrath, 1943.
NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 Nr. 375.
Anfang Juli 1943 wurde die »Kinderfachabteilung« Waldniel aufgelöst. 183 Kinder und Jugendliche wurden auf die »Kinderfachabteilungen« in Ansbach, Görden, Uchtspringe, Ueckermünde und Lüneburg aufgeteilt. Am 3. Juli 1943 wurden insgesamt 38 Kinder und Jugendliche aus Waldniel in die Lüneburger »Kinderfachabteilung« gebracht. Zwischen Juli 1943 und Dezember 1945 starben mindestens 25, einer von ihnen war Wilhelm Schaffrath.
KINDER AUS WALDNIEL
Im Juli 1943 schließt die Kinder-Fachabteilung
in Waldniel.
Alle Kinder aus Waldniel kommen in andere Anstalten.
Sie kommen nach:
• Ansbach.
• Görden.
• Uchtspringe.
• Ueckermünde.
• Lüneburg.
Die meisten Kinder aus Waldniel kommen
nach Lüneburg.
Es sind 38 Kinder.
25 Kinder aus Waldniel werden in Lüneburg ermordet.
Ein Kind ist Wilhelm Schaffrath.
WILHELM SCHAFFRATH (1936 – 1943)
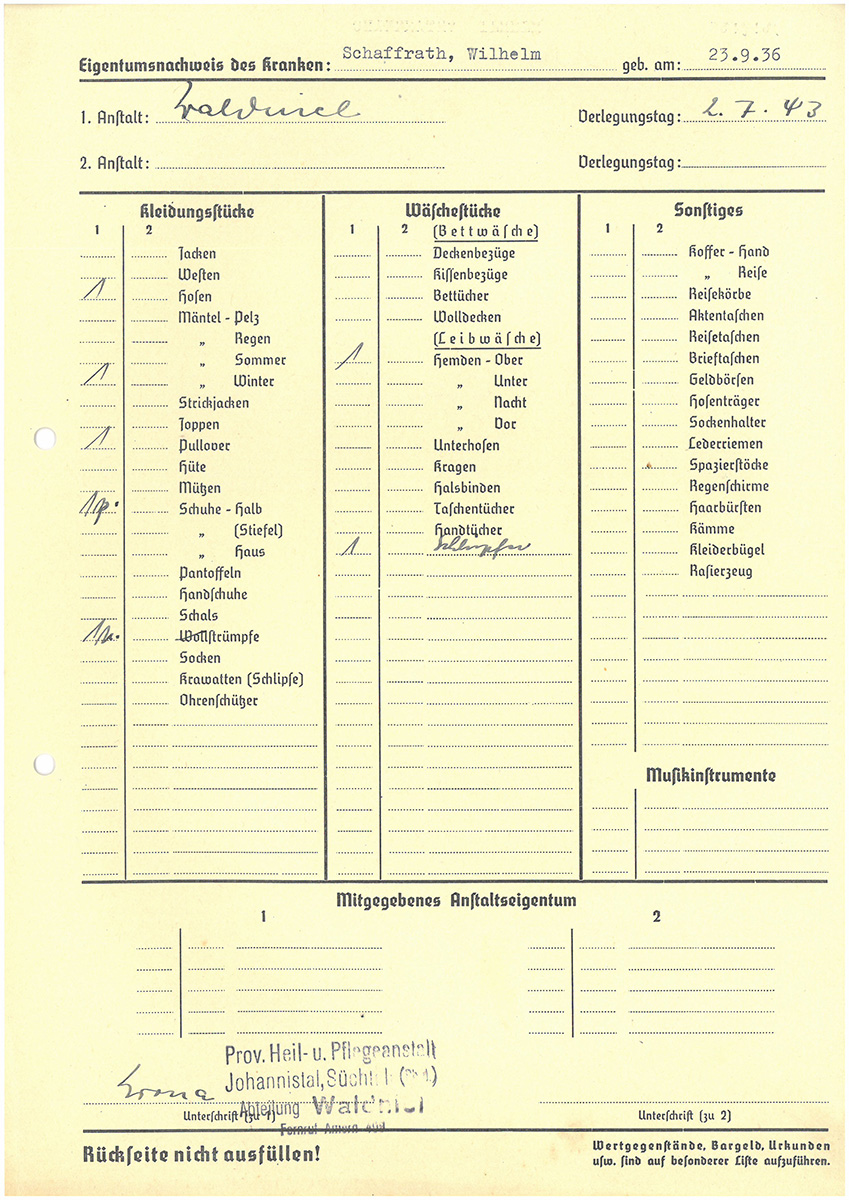
Auszug aus der Krankenakte, Sachenliste von Wilhelm Schaffrath, 1943.
NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 Nr. 375.
Wilhelm Schaffrath aus Euskirchen kam 14 Tage vor Schließung der »Kinderfachabteilung« nach Waldniel. Von der Aufnahme dort bis zu seiner Ermordung in Lüneburg vergingen nur neun Wochen, da er aus Sicht von Willi Baumert als
»völlig gemeinschaftswidrig und lebensunwert«
NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 Nr. 375.
bewertet wurde. Er kam nur mit den Kleidungsstücken nach Lüneburg, die er am Körper trug. Mehr hatte man ihm nicht mitgegeben.
WILHELM SCHAFFRATH
Wilhelm Schaffrath kommt aus Euskirchen.
Er kommt in die Kinder-Fachabteilung nach Waldniel.
14 Tagen später macht die Kinder-Fachabteilung
in Waldniel zu.
Wilhelm Schaffrath kommt
in die Kinder-Fachabteilung nach Lüneburg.
Er bringt nichts mit aus Waldniel.
Er hat nur die Kleidung, die er trägt.
Das ist alles, was er hat.
Willi Baumert sagt:
Wilhelm Schaffrath ist dumm.
Er kann nicht mit vielen Menschen zusammen sein.
Wilhelm Schaffrath war im Alter von sechs Jahren zusammen mit seinen vier Geschwistern in die Fürsorgeerziehung gekommen. Sie hatten zu Hause viel Gewalt erlebt. Auch in der Fürsorgeerziehung hörte die Gewalt nicht auf. Wilhelm wurde als »erziehungsunfähig« in die »Kinderfachabteilung« zwangseingewiesen.
Wilhelm Schaffrath hat 4 Geschwister.
Zu Hause gibt es viel Gewalt.
Man holt ihn und seine Geschwister
aus der Familie raus.
Da ist Wilhelm 6 Jahre alt.
Wilhelm kommt in ein Heim.
Dort gibt es auch Gewalt.
Er kommt in die Kinder-Fachabteilung nach Lüneburg.
Nach 9 Wochen ist Wilhelm tot.
Er stirbt durch den Kinder-Mord.
Das ist ein Bericht
über Wilhelm Schaffrath aus dem Jahr 1943.
In dem Bericht steht,
was Wilhelm in der Nazi-Zeit erlebt.
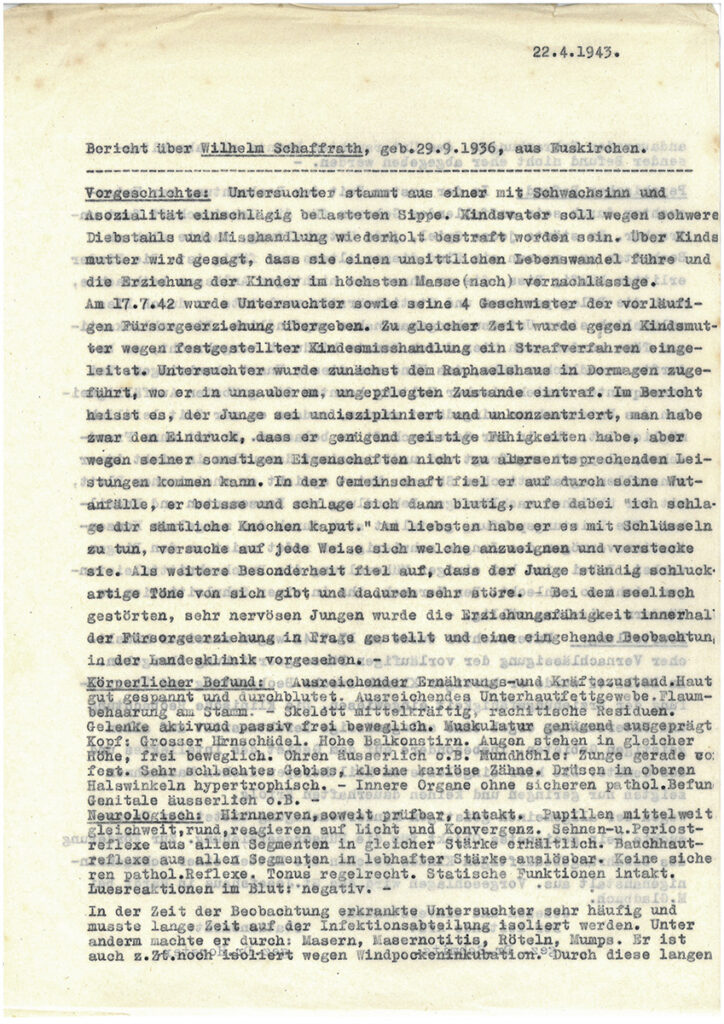
Auszug aus dem Bericht der Fürsorgeerziehung vom 22.4.1943.
NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 Nr. 375.
Ab 1944 nahm die »Kinderfachabteilung« Lüneburg etwa zehn Kinder aus den Niederlanden und Belgien auf. Sie waren mit oder ohne Eltern geflüchtet und wurden von Helfer*innen der NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) für die Aufnahme in die »Kinderfachabteilung« gemeldet. Andere waren Kinder von Zwangsarbeiterinnen aus Russland, den sowjetischen Teilstaaten und Polen. Sie kamen mit ihren Müttern zunächst in die »Ausländersammelstelle« oder waren den Müttern im Lager weggenommen worden.
Viele Kinder sind in der Kinder-Fachabteilung
in Lüneburg.
Es gibt auch Kinder in der Kinder-Fachabteilung, die nicht aus Deutschland sind.
Sie kommen zum Beispiel aus West-Europa:
aus Belgien oder aus den Niederlanden.
Diese Kinder sind Flüchtlinge.
Sie müssen weg aus ihrer Heimat.
Einige Kinder kommen allein nach Deutschland.
Einige Kinder kommen zusammen mit ihren Eltern nach Deutschland.
Auch Kinder aus Ost-Europa kommen in die Anstalt nach Lüneburg: aus Russland, aus der Ukraine und
aus Polen.
Sie sind oft Kinder von Zwangs-Arbeitern.
Oder sie kommen aus einem Lager.
Dort hat man sie den Müttern weggenommen.
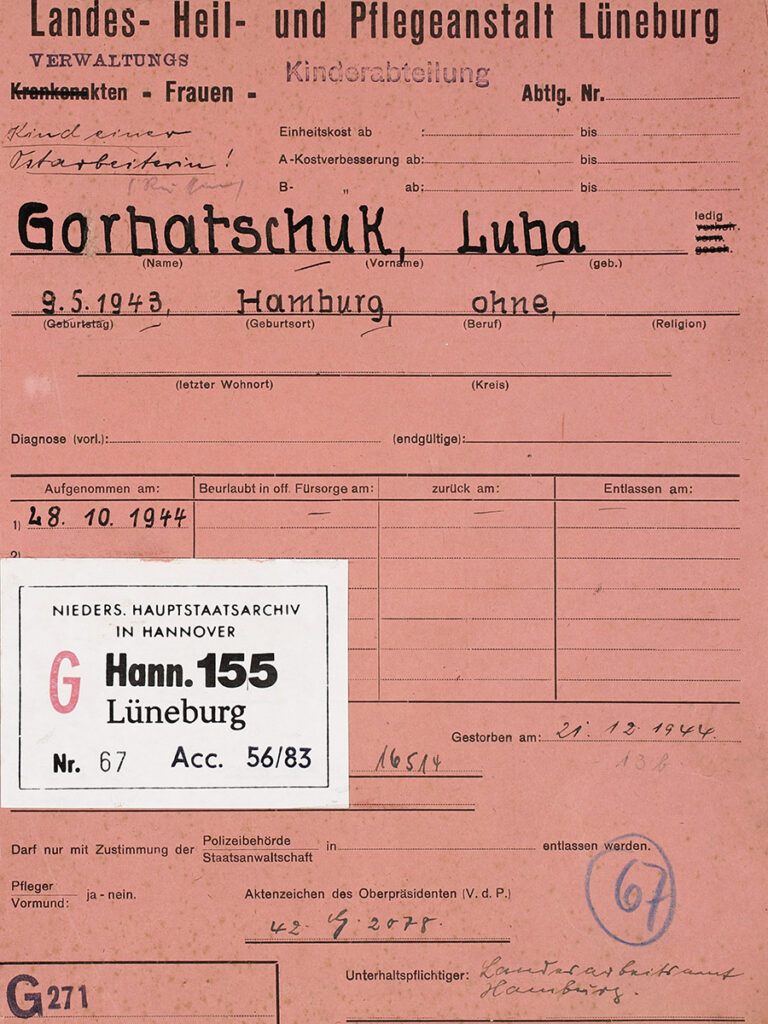
Deckel der Krankenakte von Luba Gorbatschuk, 1944.
NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 Nr. 67.
Die Kinder von Zwangsarbeiterinnen überlebten in der Regel nur wenige Wochen, weil die Übernahme der Pflegekosten nicht gesichert war. Dabei spielte es keine Rolle, ob sie tatsächlich erkrankt oder entwicklungsverzögert waren. Luba Gorbatschuk (1943 – 1944) kam in die »Kinderfachabteilung«, weil ihre Mutter aus dem Lager weggelaufen war und die Lagerleitung sie loswerden wollte. Luba hatte keinerlei Auffälligkeiten, außer dass sie gerade ihre ersten Zähne bekam.
Man behandelt nicht alle Kinder gleich
in der Kinder-Fachabteilung.
Die Kinder von Zwangs-Arbeitern behandelt man besonders schlecht.
Sie werden nach kurzer Zeit ermordet.
Auch gesunde Kinder werden ermordet.
Man ermordet sie, weil sie keine Deutschen sind.
Luba Gorbatschuk ist so ein Kind.
Ihre Mutter läuft aus einem Arbeits-Lager weg.
Die Lager-Leitung entscheidet:
Die Mutter ist weg.
Dann muss das Kind auch weg.
Luba kommt in die Kinder-Fachabteilung.
Dort wird sie nach 7 Wochen ermordet.
Die niederländischen Eltern von Benni Hiemstra waren Nationalsozialisten. Im August 1944 flüchteten sie ins Reich. Sie hofften, so den Alliierten zu entkommen. Benni war sieben Jahre alt, als er im Flüchtlingslager in der Schule in Amelinghausen gemeldet und dann in die »Kinderfachabteilung« eingewiesen wurde. Er starb innerhalb von nur drei Wochen.
Benni Hiemstra ist ein Flüchtlings-Kind.
Er flüchtet mit seinen Eltern aus den Niederlanden
nach Deutschland.
Die Eltern haben Angst vor den Engländern.
Denn die Eltern sind niederländische Nazis.
Sie wollen Rettung in Deutschland.
Sie kommen in ein Flüchtlings-Lager.
Dort wird Benni gemeldet,
weil er eine Behinderung hat.
Er kommt in die Kinder-Fachabteilung.
Er wird nach 3 Wochen ermordet.

Benni Hiemstra, um 1938.
Privatbesitz Johan Huismann | Tine Ovinck-Huismann.
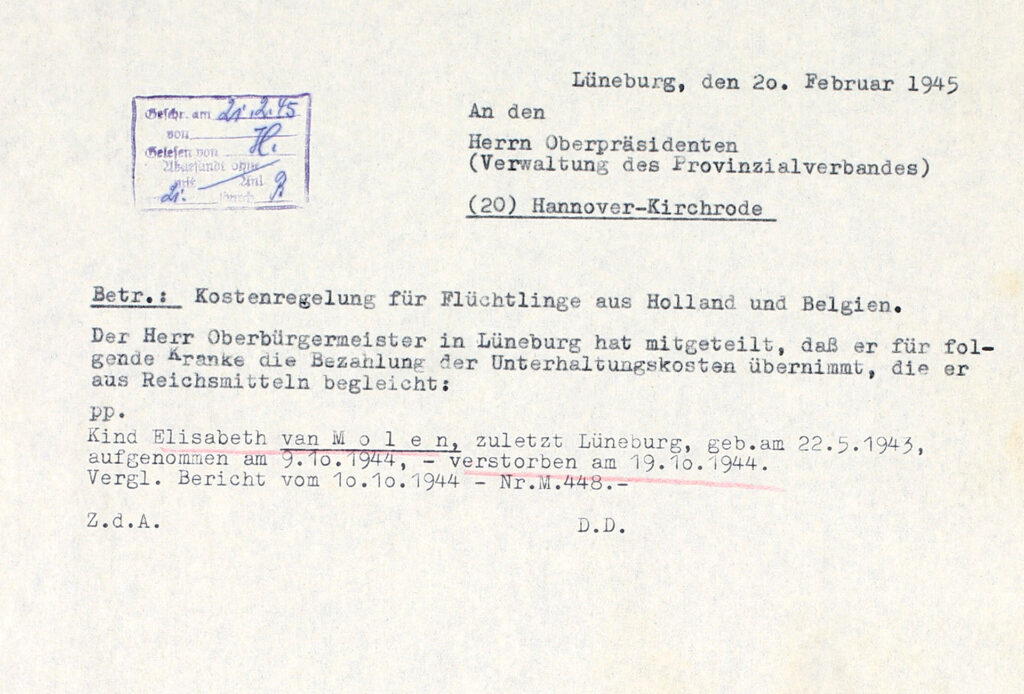
Brief der Stadt Lüneburg über die Kostenübernahme vom 20.2.1945.
NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 Nr. 136.
Elisabeth van Molen und Dieter Lorenz waren im Rahmen der NSV-Jugendhilfe-Westaktion ohne Eltern aus den Niederlanden ins Reich gebracht worden. Sie wurden nach nur wenigen Tagen ermordet. Bei ihnen war entscheidend, dass die Stadt Lüneburg zögerte, die Pflegekosten für die elternlosen Kinder zu übernehmen. Erst im Februar 1945 entschied die Stadt, die Kosten zu tragen. Da waren beide Kinder bereits tot.
Elisabeth van Molen und Dieter Lorenz kommen
aus den Niederlanden.
Beide Kinder kommen ohne Eltern nach Lüneburg.
Sie kommen in die Kinder-Fachabteilung.
Sie haben keine Kranken-Versicherung.
Keiner kennt die Eltern.
Keiner bezahlt für die Pflege.
Darum soll die Stadt Lüneburg
für die Kinder bezahlen.
Im Februar 1945 entscheidet die Stadt:
Wir bezahlen für die Pflege von Elisabeth van Molen und Dieter Lorenz.
Da sind die Kinder aber lange schon tot.
Sie wurden nach 2 und 3 Wochen ermordet,
weil sie zu viel Geld gekostet haben.
DIETER LORENZ (1942 – 1944)
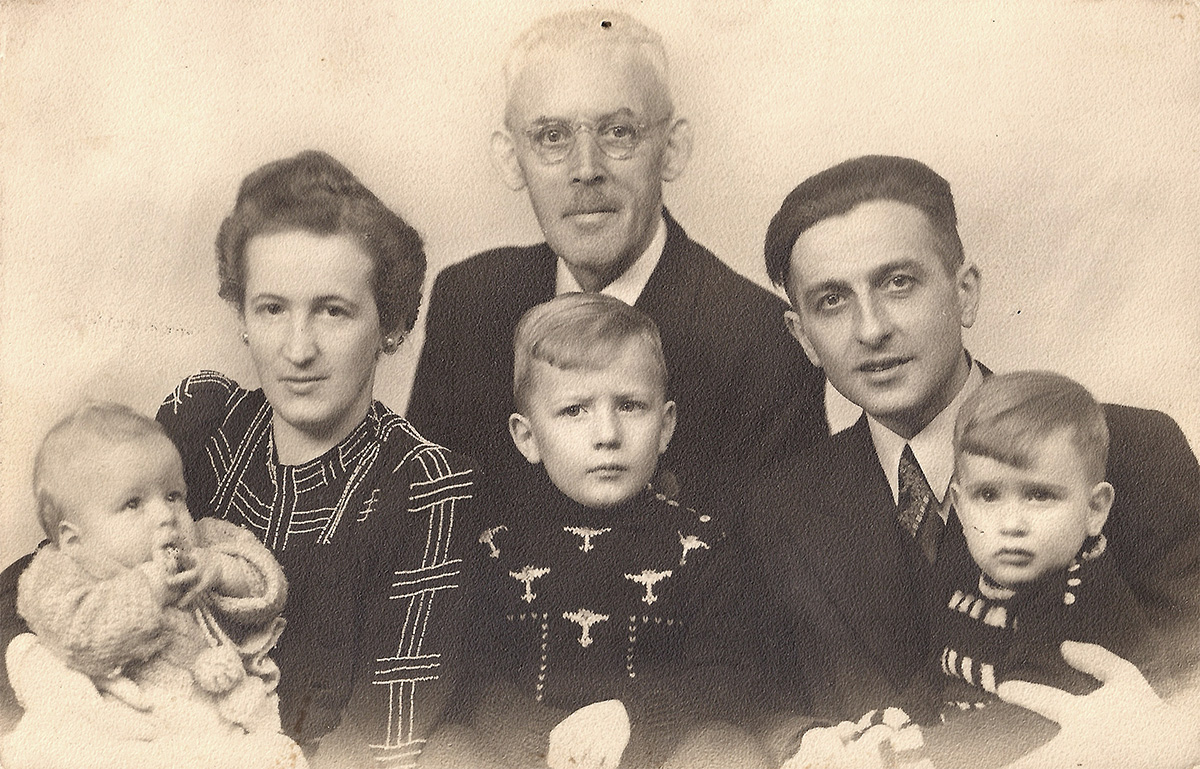
Familienfoto mit Dieter, Rolf und Helmut Lorenz (Vordergrund von links nach rechts), Aenne und Erich Lorenz dahinter und ganz hinten Heinrich Wilhelm Vennemann, Dieters Großvater, etwa Herbst 1942.
Privatbesitz Helmut Lorenz.
Dieter Lorenz wurde am 26. Februar 1942 in Eindhoven in den Niederlanden geboren. Sein Vater Erich war Kaufmann und stammte aus Schmölln in Thüringen. Seine Mutter Aenne (geborene Vennemann) war Niederländerin und Apothekerin. Sie heirateten 1934 und bekamen drei Söhne: Rolf, Helmut und Dieter.
DIETER LORENZ
Dieter Lorenz ist im Jahr 1942 geboren.
Seine Eltern haben ein Werkzeug-Geschäft.
Er hat 2 Brüder: Rolf und Helmut.
Sie leben in den Niederlanden.
Das ist ein Foto von Familie Lorenz
aus dem Jahr 1942.
Dieter ist da noch ein Baby.
Seine Mutter hat ihn auf dem Arm.

Rolf, Dieter und Helmut Lorenz, Eindhoven, Frühjahr 1943.
Privatbesitz Helmut Lorenz.
Weil Erich in die Wehrmacht eingezogen wurde und Aenne ab dann das Werkzeuggeschäft alleine führen musste, gab sie Dieter vorübergehend in ein Kinderheim. Anfang September 1944 wurde es geräumt, ohne die Eltern zu informieren. Die vergebliche Suche nach Dieter begann. Erich ließ sich zu Kommandos versetzen, wo Aenne in Erfahrung gebracht hatte, dass Dieter in der jeweiligen Gegend sein könnte.
Der Vater von Dieter Lorenz ist Deutscher.
Er muss als Soldat in den Zweiten Weltkrieg.
Dieters Mutter muss das Werkzeug-Geschäft
alleine führen.
Das schafft sie nicht mit Dieter.
Darum kommt Dieter in ein Kinderheim.
Da ist er 2 Jahre alt.
Wenig später muss das Kinderheim umziehen.
Dieter und ein anderes Mädchen kommen nach Lüneburg in ein anderes Heim.
Das ist ein Heim für Kinder-Flüchtlinge ohne Eltern.
Die Eltern wissen nicht,
dass ihre Kinder nun woanders sind.
Keiner sagt ihnen das.
Die Eltern fangen an, nach ihren Kindern zu suchen.
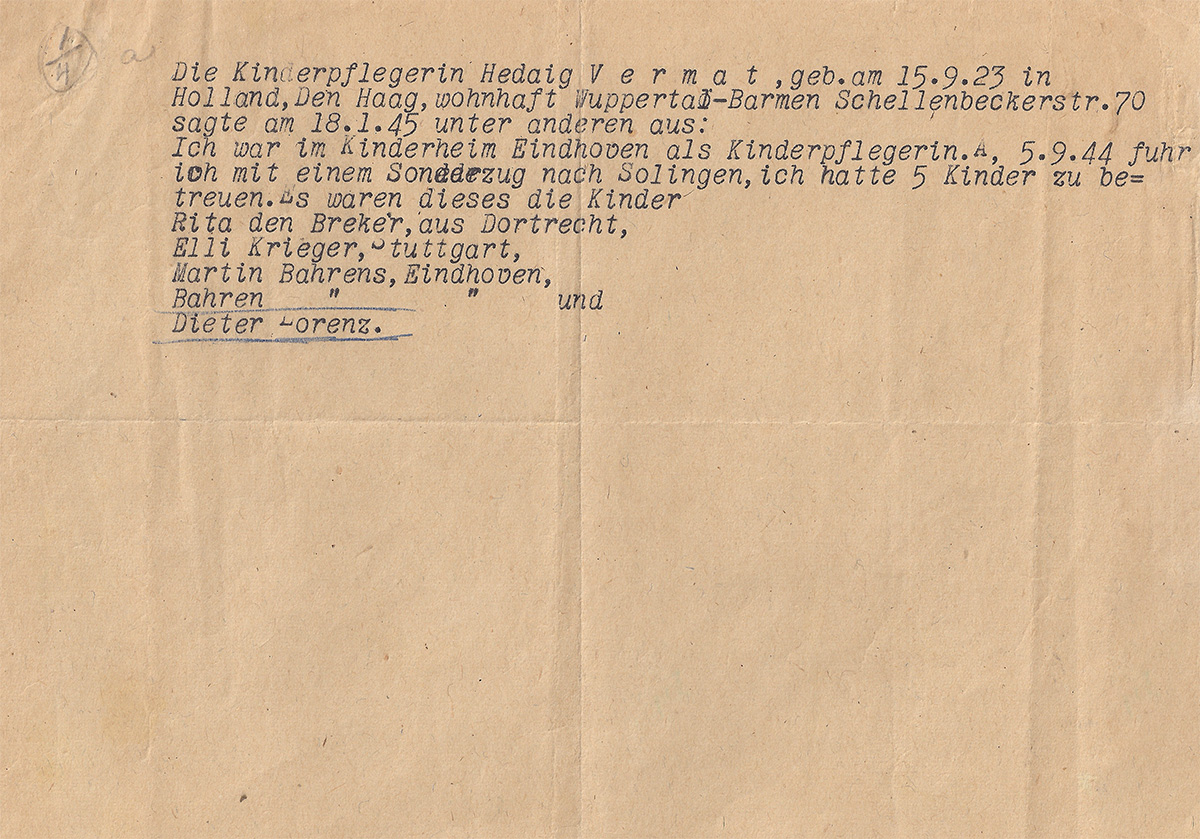
Vermerk, ohne Verfasser, ohne Datum, Dezember 1944.
Privatbesitz Helmut Lorenz.
Dieter kam über Hilden bei Solingen und Hannover nach Lüneburg in ein Auffanglager für elternlose Kinder. Dort wurde er selektiert und am 28. November 1944 in die »Kinderfachabteilung« Lüneburg eingewiesen. Er hatte eine Schachtel dabei, auf der sein Name »Lorenz« geschrieben war. Weil Rita den Breker, ein Mädchen aus dem Kinderheim, ihn als ihren »Bruder Dieter« bezeichnete, wurde er als »Dieter Lorenz« aufgenommen.
Dieter spricht nicht.
Keiner weiß, wie er heißt.
Nur das Mädchen Rita weiß es.
Sie sagt: Das ist Dieter.
Dieter hat eine Schachtel dabei.
Auf der Schachtel steht: Lorenz.
Darum wissen alle: Das ist Dieter Lorenz.
Die Frau vom Heim in Lüneburg sagt:
Dieter hat eine Behinderung.
Er muss in die Kinder-Fachabteilung.
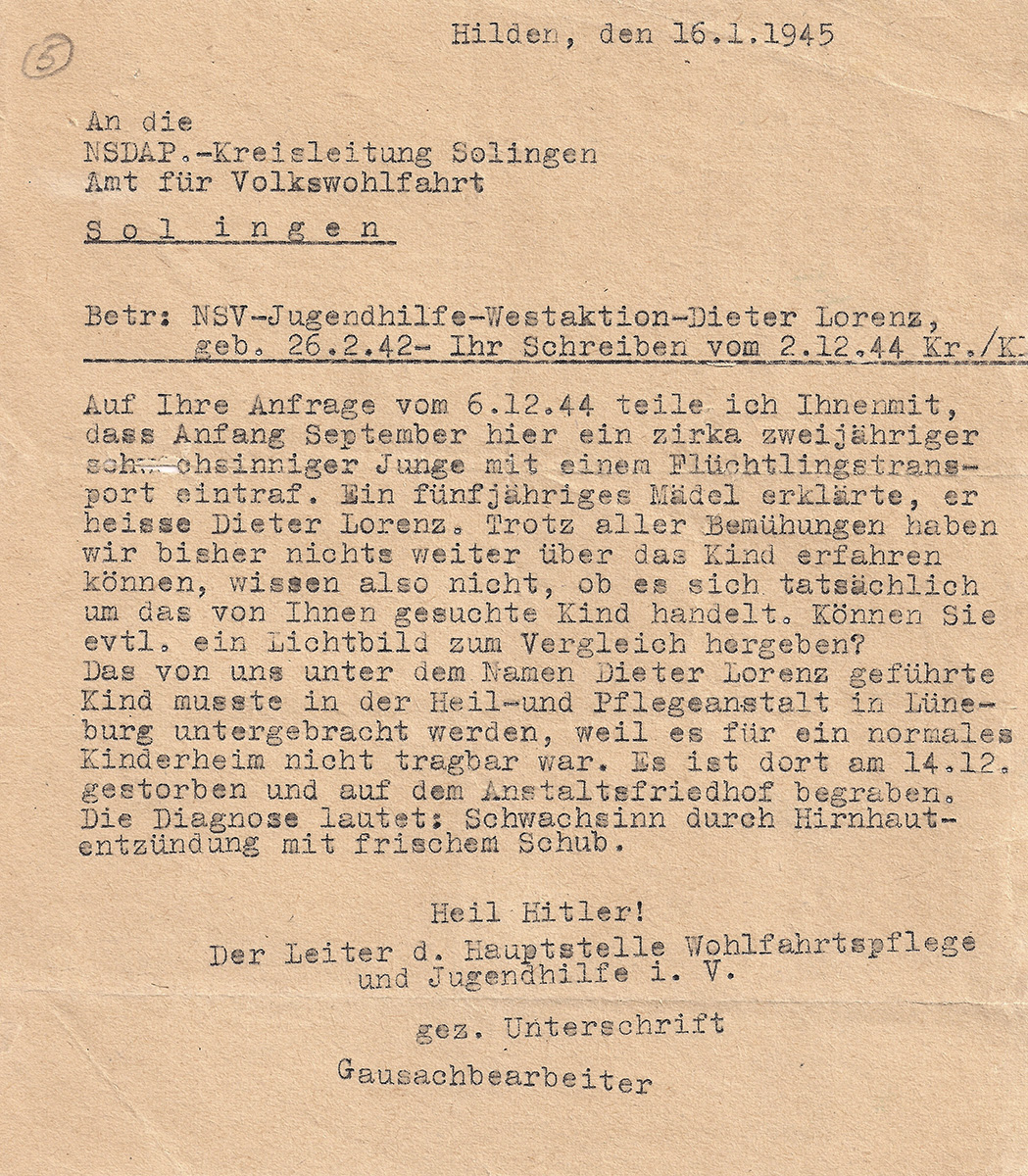
Schreiben der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe Hilden an die NSDAP-Kreisleitung Solingen, 16.1.1945.
Privatbesitz Helmut Lorenz.
Bei seiner Aufnahme wurde bei Dieter eine geistige Behinderung diagnostiziert. Weil angenommen wurde, er habe keine Eltern und die Stadt Lüneburg zunächst keine Kostenübernahme für das nicht-deutsche Kind zusicherte, wurde er 16 Tage nach seiner Aufnahme ermordet. Dieter starb am 14. Dezember 1944.
Die Anstalt in Lüneburg will Geld
für die Pflege von Dieter Lorenz.
Alle denken: Dieter hat keine Eltern.
Er hat keine Kranken-Versicherung.
Die Stadt Lüneburg überlegt,
ob sie für die Pflege von Dieter bezahlt.
Max Bräuner wartet nicht auf die Antwort
von der Stadt Lüneburg.
Nach 16 Tagen wird Dieter ermordet.
Damit er kein Geld mehr kostet.
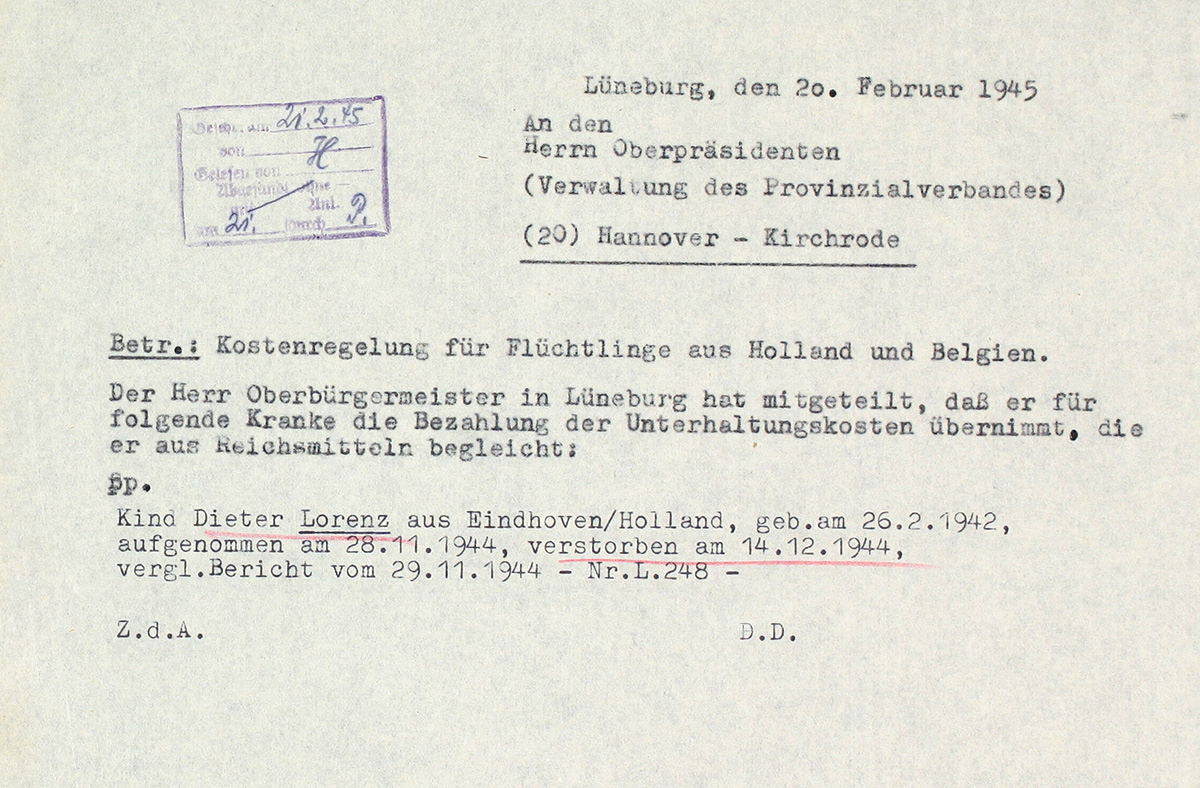
Schreiben vom 20.2.1945.
NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 Nr. 311.
Die Stadt Lüneburg erklärt sich am 20. Februar 1945 bereit, die Kosten für Dieters Aufenthalt zu übernehmen. Da ist er schon seit über zwei Monaten tot.
Ende Februar 1945 schreibt die Stadt Lüneburg:
Wir bezahlen für Dieter Lorenz.
Aber da ist Dieter schon 9 Wochen tot.
Dieters Eltern erfuhren erst im Januar 1945 von seinem Tod. Die Brüder erfuhren nie, dass Dieter eine Behinderung hatte. Man erzählte ihnen, er sei mit einem Bus des Roten Kreuzes verlorengegangen. Daraufhin suchte Helmut Lorenz seinen kleinen Bruder fast weitere 70 Jahre. 2014 konnte Dieters Schicksal aufgeklärt werden.
Die Eltern von Dieter Lorenz bekommen
die Todes-Nachricht im Januar 1945.
Aber sie wollen es nicht glauben.
Sie sagen:
Vielleicht lebt Dieter noch.
Helmut Lorenz sucht seinen Bruder Dieter
70 Jahre lang.
Im Jahr 2015 findet er die Wahrheit raus.
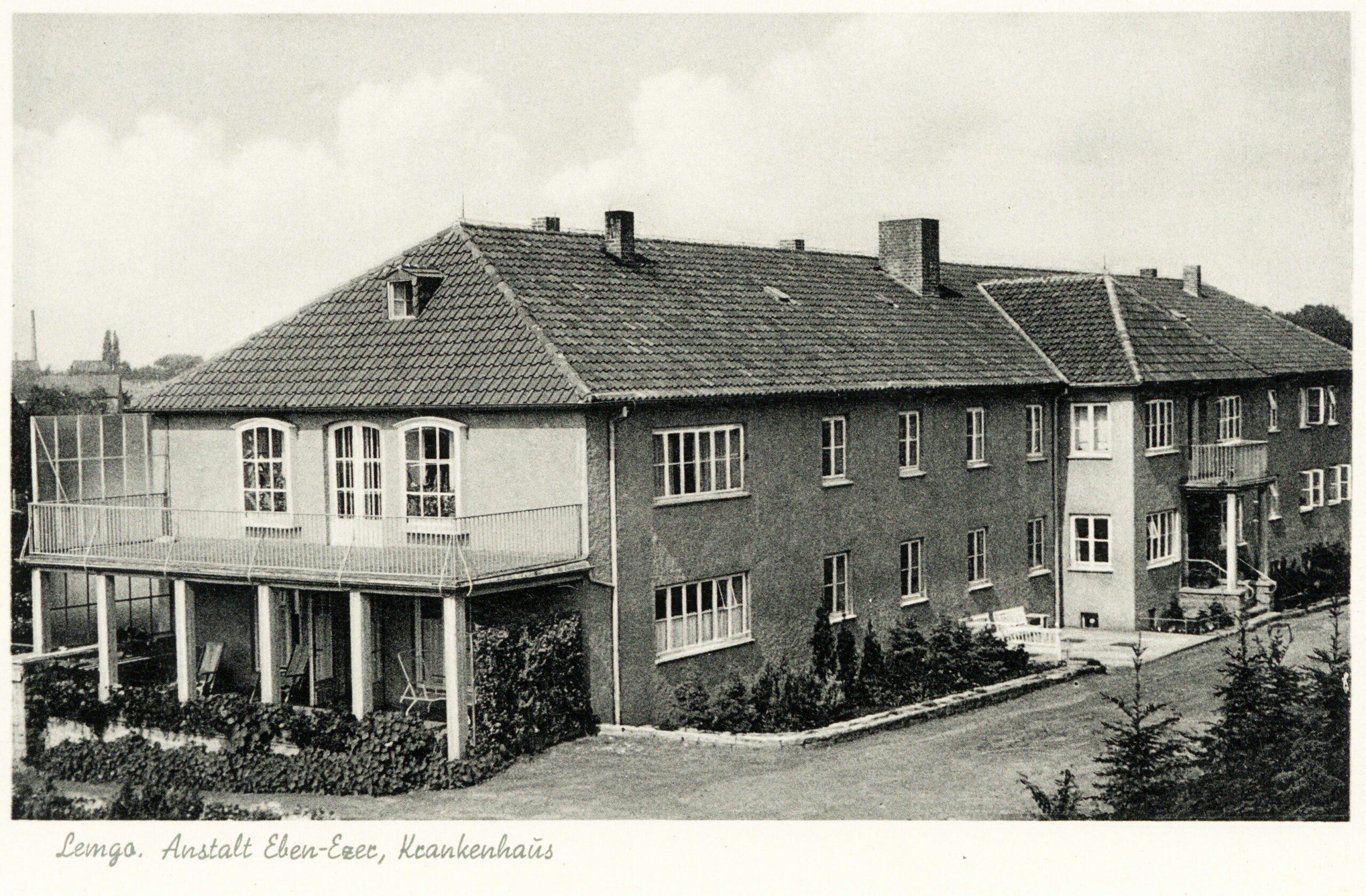
Postkarte der Anstalt Eben-Ezer in Lemgo, nach 1945.
NArEGL 99.
Etwa 40 Prozent der eingewiesenen Kinder und Jugendlichen überlebten die »Kinderfachabteilung« Lüneburg. 103 Kinder (39 Mädchen, 64 Jungen) wurden für einen »Beschulungsversuch« nach Lemgo (Eben-Ezer) verlegt. Dort gab es eine Hilfsschule. Elf von ihnen wurden zurücküberwiesen, Gertrud Krebs und Kurt Bock starben dadurch. Auch die Stiftung Eben-Ezer war kein sicherer Ort. Es sind zwölf weitere Kinder und Jugendliche bekannt, die die Stiftung von sich aus in die »Kinderfachabteilung« einwies.
Wenige Kinder überleben
in der Kinder-Fachabteilung in Lüneburg.
Nur etwa eins von 3 Kindern überlebt.
103 Kinder verlassen die Kinder-Fachabteilung.
Zwischen 1941 und 1945.
Sie kommen nach Lemgo in die Stiftung Eben-Ezer.
Dort gibt es eine Hilfsschule.
Sie sollen dort zur Schule gehen.
11 Kinder schaffen die Hilfsschule nicht.
Sie kommen zurück in die Kinder-Fachabteilung nach Lüneburg.
2 Kinder sterben dann in der Kinder-Fachabteilung.
In Eben-Ezer sind die Kinder auch nicht sicher.
12 Kinder aus Eben-Ezer kommen auch
in die Kinder-Fachabteilung.
Weil sie ihren Namen und ihr Alter kannte, sich benahm und interessiert zeigte, überwies Willi Baumert Gertrud Krebs bereits sechs Wochen nach ihrer Aufnahme nach Eben-Ezer. Ein Jahr später kam sie als »nicht schulfähig« zurück. Handschriftlich notierte Max Bräuner im November 1944, dass es keine Besuche und Anfragen gab. Dies war auch deshalb unwahrscheinlich, weil sie zu Anfang aus einem Kinderheim aus Amt Neuhaus eingewiesen worden war. Drei Monate nach diesem Eintrag lebte sie nicht mehr.
Gertrud Krebs ist in der Kinder-Fachabteilung
in Lüneburg.
Sie weiß ihren Namen.
Sie weiß ihr Alter.
Sie fragt viel.
Sie versteht viel.
Darum sagt der Arzt Willi Baumert:
Gertrud soll auf eine Hilfsschule.
Sie soll nach Eben-Ezer.
Das passiert dann auch.
Ein Jahr später kommt Gertrud zurück
in die Kinder-Fachabteilung.
Die Lehrer sagen:
Sie ist schlecht in der Schule.
Sie ist zu dumm für eine Hilfsschule.
Max Bräuner schreibt:
Keiner besucht Gertrud.
Keiner fragt nach ihr.
Er denkt:
Es stört keinen, wenn Gertrud stirbt.
3 Monate später ist Gertrud tot.
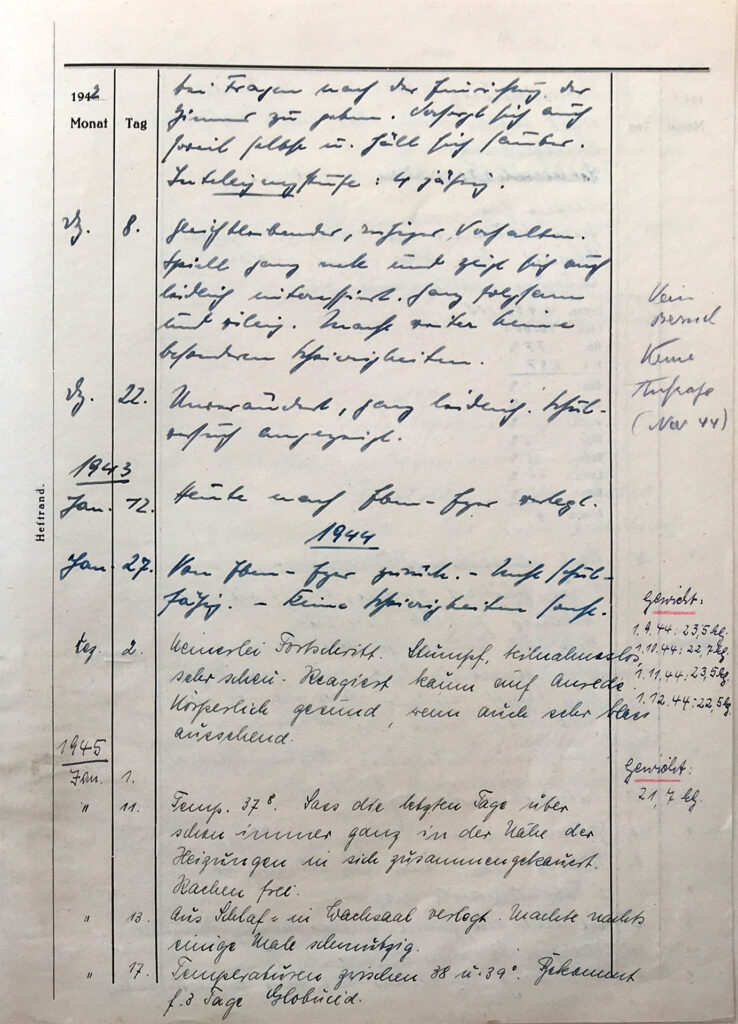
Auszug aus der Krankengeschichte von Gertrud Krebs.
NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 Nr. 110.